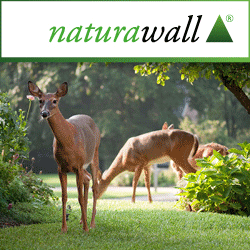Ein Fachbeitrag von Thomas Jacob, vom 20.02.2017, überarbeitet 4/2023
So mancher Kleingärtner war in der Vergangenheit durch Pressemitteilungen und teils widersprüchliche Aussagen in den Medien verunsichert, wenn es um die private Weitergabe und im kleinen Stil auch um die Vermarktung von Saatgut aus dem eigenen Garten geht. Hier gilt es jedoch klar zu unterscheiden, ob wir z.B. Gemüsesorten auf denen Sortenschutz besteht, weiter vermehren oder ob wir sogenannte alte Sorten weiter-züchten und diese tauschen oder als Privatperson verkaufen.
Überwiegend handelt es sich bei dieser Weitergabe um alte freie Sorten, deren Erhaltung uns am Herzen liegt. Das Problem dabei ist, dass das Wieso und Warum nicht nur von uns missverstanden wird, sondern offensichtlich auch von gesetzgebender Seite. Darauf gehe ich im vorliegenden Beitrag ein. Allerdings wird die Sache noch etwas komplizierter, denn der Gesetzgeber verbietet nicht nur die unberechtigte Weitervermarktung von geschützten Pflanzensorten. Nein – nach deutscher Saatgutverordnung ist es verboten, staatlich nicht zugelassene Gemüsesorten überhaupt in den Handel zu bringen. Was nicht beim Bundessortenamt gelistet ist, darf eigentlich nicht gehandelt werden – so jedenfalls, die allgemein vermutete Gesetzeslage.
Doch es geht noch weiter, denn Lobbyisten und ihre Politiker (die Damen inbegriffen!) haben 2013/2014 sogar versucht, so meinten Kritiker, jedweden Gebrauch von ungelisteten Nutzpflanzensorten, bis in den Privatraum hinein, zu verbieten.
Ohne aber für die oben dargestellte Thematik weiter Gedanken und Energie zu verschwenden, vertrete ich die Auffassung, dass dieser Sichtweise ein grundlegender Fehler anhaftet. Die Richtigstellung möchte ich hier gern darlegen. Es geht mir darum aufzuzeigen, dass die alten sogenannten Gemüse-Landsorten mit denen sich die Kleingärtner vorzugsweise beschäftigen, niemals fertig gezüchtete Sorten waren und sind. Es sind lediglich Zuchtlinien. Überhaupt: Gärtner und Bauern bauten früher nie fertig gezüchtete Kulturpflanzen an. Sie waren selber Züchter wie auch Produzenten und Selbstvermarkter ihrer Produkte (man nennt dies übrigens Urproduktion). Erst der Handel von Sämereien und deren Produktbezeichnungen als Sorten schuf Probleme und Gesetze, welche es vorher nie gab.
Verwässerte Definitionen
Wie entstanden diese Probleme? Hier meine These: Spätestens im 20. Jahrhundert kam es mit dem Aufkommen der Gemüsehochzuchtsorten zu einer neuen Definition des Begriffs "Sorte" (bezogen auf Kulturpflanzen). Bis in die 1950er Jahre hinein unterschied man noch klar zwischen den sogenannten Landsorten (Gruppensorten) und daneben neu hinzugekommenen Hochzuchtsorten (Einzelsorten). Erstere wurden im Lande an mehreren Orten erhaltungs-züchterisch bearbeitet und waren genaugenommen keine fertig gezüchteten Kulturpflanzen. Letztere produzierte man nur an einer einzelnen Stelle (von einem einzelnen Unternehmen), um damit Handel zu treiben.
Ziel und Zweck dieser züchterischen Arbeit war und ist es damals wie heute, Saatgut in gleichbleibend hoher Qualität zu erzeugen.
Zudem sollten die mit dem handelbaren Saatgut angebauten Gemüse bestimmte definierte Eigenschaften konstant aufweisen. Man wollte also arbeitsteilig über den Handel hochwertiges und eigenschafts-konstantes Saatgut zur Verfügung stellen. Und das ist auch gut so. Allerdings wurde der Sinn und Begriff der oben zuerst genannten Landsorten (Gruppensorten) mit der Zeit immer mehr verwässert. Heute sprechen wir nur noch von Sorten und haben vergessen, dass sie dem Wesen nach ganz unterschiedliche und nicht vergleichbare Kulturpflanzen (inklusive Samen) sein können.
Geschichtlicher Rückblick
Wenn es im 18. Jahrhundert noch weitgehend üblich war, die angebauten Gemüsevarianten regional selber zu vermehren, so entwickelte sich im 19. Jahrhundert der Samenhandel mit der dazugehörigen Saatgutvermehrung (Saatzucht) zum florierenden Geschäft, anfangs durch Handelsgärtnereien, später durch Warenhändler und Saatzuchtbetriebe. Mit der Industrialisierung und dem raschen Wachstum der Stadtbevölkerungen und damit auch mit den Marktgärtnereien als Versorgern, wuchs auch der Bedarf an hochwertigen Gemüsesorten samt Saatgut. Eine wichtige Rolle übernahm hierbei auch der Handel, der seine Ware selbstverständlich auch genau bezeichnen musste. Begannen also zu dieser Zeit Gärtner und Züchter, gezielt Nutzpflanzen mit bestimmten Eigenschaften wie Geschmack, Größe und Ertrag zu selektieren, verwendeten die Händler zunehmend den Begriff der Sorte, um diese verschiedenen Varianten einer Kulturpflanzenart zu beschreiben und zu unterscheiden. Und je weiter es zu einer differenzierten Zucht kam, wurde eine genaue Sorten-Definition für den Handel wichtiger.
Die Sortenzucht wurde mit der Zeit aber auch immer spezieller und mitdem die Fixierung einzelner Sorten immer wichtiger. Die Entwicklung – die ich keinesfalls als negativ darstellen möchte – führte im nächsten Schritt zu den sogenannten F1-Hybriden. Die Züchtung dieser Gemüsepflanzen begann in den 1920er Jahren. Der niederländische Gärtner und Züchter Jan Leendertszoon de Jongh gilt als einer der Pioniere in dieser Entwicklung. Beim Verfahren der F1-Zucht, werden zwei separate Zuchtstämme ausgelesen, die am Ende miteinander gekreuzt werden. Die erste Generation (F1 = 1. "Kinder-Generation") dieser Pflanzen-Eltern (dieser beiden Zuchtstämme), welche aus dieser Vermischung entsteht, besitzen dann sehr konstant gleiche Eigenschaften. Dies ist die Besonderheit dieser Hochzuchtsorten. In den Gemüse-Gartenbaubetrieben wurden diese F1-Hybriden natürlich immer beliebter, weil sie sehr konstante Erträge lieferten, wiederum als Forderung des Marktes.
In den Folgejahren wurden immer mehr Gemüsepflanzen als Hybriden gezüchtet, da diese oft höhere Erträge, bessere Resistenz gegen Krankheiten und Schädlinge sowie andere wünschenswerte Merkmale aufweisen konnten und können. Heute sind F1-Hybriden in vielen Gemüsearten weit verbreitet und werden von Gärtnern und Landwirten auf der ganzen Welt angebaut.
War die Sorten- und Saatzucht noch bis in die 1980er Jahre hinein weitgehend die Angelegenheit von Gartenbaubetrieben, so haben sich in den folgenden Jahrzehnten Großkonzerne verstärkt auf dem Markt für Saatgut und Agrarchemie konzentriert und durch Fusionen und Übernahmen eine zunehmende Kontrolle über die weltweite Saatgutindustrie erlangt. Allerdings verlief diese Entwicklung auch mit der zunehmenden industriellen Pflanzenproduktion einher und ist genau genommen ein eigenes Spielfeld für sich und hat mit der gartenbau- und landwirtschaftlichen sogenannten Urproduktion und unserer Kleingärtnerei überhaupt nichts mehr zu tun. Dort, wo Kulturpflanzen als Handelsware industriell produziert werden, gibt es natürlich auch weitgehend gesetzliche Regelungen. Wie diese einst entstanden, möchte ich als nächstes thematisieren.
Gesetze und Verordnungen...
Beim Studium alter Gartenbücher ist mir immer wieder aufgefallen, dass bereits im 19. Jahrhundert hier und da darauf hingewiesen wurde, dass Samenhändler ihren Kunden häufig auch minderwertiges Saatgut verkauften. Das war nicht besonders schwer. Man mischte beispielsweise alten mit neuem Samen oder verkaufte minderwertiges Zuchtmaterial zu überteuerten Preisen. Wer seine Sämereien selber produzierte, hatte das Problem natürlich nicht, doch je mehr der Handel die Ökonomie der Gartenbaubetriebe beeinflusste, wurde eine Reglementierung der Saatzucht und des Saatguthandels von Seiten des Staates nötig.
In Deutschland verabschiedete zuerst die nationalsozialistische Regierung im vierten Jahr ihrer Amtszeit das Pflanzenzuchtgesetz von 1937 und im gleichen Jahr das Saatgutgesetz von 1937 (auch ein Rebenverkehrsgesetz?). Aufbauend auf dieser Grundlage ging es dann, um beim Beispiel Deutschlands zu bleiben, weiter mit dem: Bundesgesetz über die Saatgutanerkennung, die Saatgutzulassung und das Inverkehrbringen von Saatgut sowie die Sortenzulassung (Saatgutgesetz 1997 – SaatG 1997) mit ständigen Änderungen bis heute.
Und mit der Verordnung über den Verkehr mit Saatgut landwirtschaftlicher Arten und von Gemüsearten (Saatgutverordnung) SaatV (21.01.1986) mit ständigen Änderungen bis heute. Diese Saatgutverordnung ist übrigens als eine handelsrechtliche Verordnung erkennbar.
In Planung war dann aber auch eine EU-Saatgutverordnung, die alle Bereiche, vor allem aber den Verkauf von Saatgut regeln sollte. Man befürchtete wohl zu recht, dass das hinter verklausulierten Paragraphen das dahinter stehende Vorhaben war, den freien Austausch von Saatgut einschränken und die Vielfalt der verfügbaren Saatgutsorten reduzieren werden sollte. Der Vorschlag stieß auf starken Widerstand von verschiedenen Interessengruppen wie Bauern, Gärtner und Umweltschützern. Am 6. Mai 2013 stellte die Europäische Kommission ihre Idee einer EU-Saatgutverordnung vor, welche nach heftigen Bürgerprotesten am 11. März 2014 im "Europaparlament" mit 650 zu 15 Stimmen abgelehnt wurde.
Abgesehen davon, dass es für die Öffentlichkeit kaum ein besseres Beispiel gibt, um zu zeigen, wessen Interessen die EU-Kommissare vertreten, zeigen uns ähnliche Gesetzesprojekte in der Welt (siehe Quellen und Hinweise unten), wohin die Reise wohl gehen sollte.
[Einschub: Heute, am 7. Juni 2023 erfuhr ich über den Österreicher Verein ARCHE NOAH, dass im Juli 2023 – also nach ca. 10 Jahren Stillhaltephase der EU – ein erneuter Entwurf der Europäischen Kommission zu einem "neuen" bzw. "reformierten" EU-Saatgut-Recht angekündigt ist. Diesbezüglich gibt es einen offenen Brief von 38 Unterzeichnern (Vereine) aus 21 Ländern um die EU-Kommissare an die „Farm-to-Fork“-Strategie, die EU-Biodiversitätsstrategie 2030 und die EU-Klimaverpflichtungen zu erinnern; Vielfaltssorten, bestehende Amateursorten und Erhaltungssorten von Kulturpflanzen sollen, so die Unterzeichner, erhalten bleiben.]
Die Alternative
Es gibt aber noch eine ganz andere Herangehensweise, welche zunächst allerdings nur die Kleingärtner, Selbstzüchter und Selbstvermarkter betrifft. Dieser neu überdachte Umgang und Anbau von Gemüsen, wird meiner Ansicht nach von den oben genannten "Handelsgesetzten" nicht berührt. In dieser Richtung sollten Bürgerrechtler auch aktiv werden, ihre "alten Rechte" (Menschenrechte) und Besitzstände verteidigen und somit die Nutzpflanzenvielfalt bewahren.
Die oben erwähnten Gesetze und Verordnungen beziehen sich ihrem Wesen nach auf den Anbau von Lebensmitteln für den Handel, wobei mitunter (nach meiner Beobachtung) der rechtliche Winkelzug Anwendung findet, dass z.B. beim Gemüse auch der Samen das zu handelnde Lebensmittel oder das genehmigungspflichtige Lebensmittel (Gesundheitsgründe) verkörpert. Deswegen werden in manchen Staaten Lebensmittelgesetze auch auf das Saatgut übertragen.
Erinnern wir uns aber an die besagte Vorgeschichte, als es noch gar kein handelbares Gemüsesaatgut gab. Damals herrschte das alte Bauernrecht. Getreu dem Subsidiaritätsprinzip war der Bauer oder Gärtner die rechtliche Instanz, die über Pflanzenvermehrung und Anbau entschied. Der Bauer griff bei seiner Arbeit auf Zuchtlinien selbstausgelesener Kulturpflanzen zurück, welche die verschiedensten Völker seit der Jungsteinzeit als Nahrungs- und Futtermittel verwendeten. Es gab in jener Zeit keine fertigen Sorten im heutigen Sinne. Der Samenkauf für die Produktion war sicher nicht die Regel, denn das Risiko war dann doch zu hoch, die Katze im Sack gekauft zu haben. Bauern und Gärtner züchteten beständig ihre "Landsorten" selber und qualitativ weiter, natürlich auch mit überregionalem genetischen Transfer.
Ein Beispiel: Ein Rittergutsbesitzer brachte von seiner Italienreise neue, interessante Sämereien wie z.B. italienischer Blumenkohl (Romanesco) mit. Diesen kultivierte eine Bäuerin zunächst für drei oder vier Jahre in ihrem Garten mit besonderer Aufmerksamkeit und mit dem jährlich neu gewonnenen Saatgut. In diesem Zeitraum passen sich fremde Gemüsepflanzen genetisch und memetisch an den neuen Standort an. Ab dem dritten Jahr mag dann die Bauersfrau den neuen, italienischen Blumenkohl umfänglicher vermehrt haben, indem von dieser neuen "Landsorte" nur bestimmte Mutterpflanzen für das Saatgut ausgewählt wurden. Vielleicht waren es diejenigen Pflanzen, welche besonders zeitig ihre "Kohlblumen" ausbildeten. Der Ertrag deckte bald den Eigenbedarf des Ritterguts und darüber hinaus die Nachfrage auf den umliegenden Märkten (Selbstvermarkter). Die Bäuerin hatte somit frühen italienischen Blumenkohl im Angebot aber keine bestimmte Sorte nach unserem heutigen Verständnis. Allerdings ist es ziemlich aufwändig, guten Blumenkohlsamen zu ziehen. Wenn sich die Bäuerin aus Bequemlichkeitsgründen nun aber den Samen in Erfurt per Katalog bestellte, und das war schon um 1770 möglich, hebelte sie ihr altes Gewohnheitsrecht (Bauernrechte, welche mehr gelten als staatliche Privilegien) selber aus und begab sich mit ihren Geschäften ins sogenannte Handelsrecht.
Dieser Rechtskreis ist heute ein unüberschaubares Konstrukt und ohne fachlichen Beistand nicht zu überschauen. Das Gewohnheitsrecht (man mag es auch Ureinwohnerrecht nennen) hingegen verblieb einfach. Alte Rechte haben Bestand, sowie die alten Rechte der indigenen Bevölkerung eines Landes.
Meine Vorschläge sind deshalb diese (Achtung, das ist keine Rechtsberatung.):
- geh nie freiwillig ins Handelsrecht, bleib möglichst Selbstversorger oder Selbstvermarkter – ich jedenfalls vermute, dass Selbstvermarkter keine Händler sind!
- ändere deine Sprache; sprich wieder von Landsorten oder Gruppensorten und definiere sie als Zuchtlinen und/oder genetisches Material
- versteh die Landsorten als eine den Menschen begleitende Natur (Menschen-Begleitnatur) – sie sind kein menschliches Produkt
- besinne dich auf deine besonderen Rechte, wenn du indigene Bewohner deines Landes bist und fordere diese Rechte ein
Video-Notizen zur Thematik (Mitte Februar 2017, "Projekt Weiterzüchten")
Quellen, Hinweise und Notizen:
- DDR Ministerium für Land- und Forstwirtschaft; "Ratgeber zur Sortenwahl landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Pflanzenarten"; Berlin 1951
- http://www.anwalt.org/agrarrecht/ (Stand 20.2.2017)
- http://www.erfurt.de/ef/de/engagiert/ef/blumenstadt/index.html
- eine vergleichbare Definition gegenüber der Landsorten ist heute vielleicht der Begriff der Amateursorten
- das Saatgutverkehrsgesetz unterscheidet in § 2 zwischen Saatgut und Vermehrungsmaterial
- beachte: die "Saatgutgesetze" beginnen zunächst mit Begriffsbestimmungen
- die Landsorten gehören eigentlich nicht in Samenbanken, sondern sind die lebendige Weitergabe variierenden Genmaterials; sie definieren sich durch die Nutzung
- https://homment.com/EU-Saatgut-Verordnung
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20220101&from=EN (weitere Regelungen zur Thematik des Inverkehrbringens von Bio-Erzeugnissen)
Gesetzeswerke, welche ähnlich der EU-Saatgutverordnung (20139 eine Zeit lang in Kraft waren und über die man sich weiter informieren kann. Meine Recherchen hierzu sind noch etwas spärlich, und ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit! So gab es
- eine repressive Saatgutverordnung gegenüber den Bürgerrechten ist seit 2005 Kolumbien in Kraft, die als "Ley de Semillas" bekannt ist, oder Gesetz 970 von 2005; es gab in der Vergangenheit Versuche, das Gesetz zu ändern oder aufzuheben, aber es ist derzeit immer noch in Kraft.
- Regelungen in Kanada und den U.S.A. (nur einige US-Staaten?), wo es seit einigen Jahren per Gesetz (angeblich?) untersagt ist, Heilkräuter selber im Garten anzubauen, privat anzuwenden, weiterzugeben und öffentlich Aussagen über die medizinischen Heilwirkungen dieser Pflanzen zu machen. Das betrift neben Cannabis wohl auch den Kratombaum (Mitragyna speciosa) oder Peyote (eine Kakteenart, die von indigenen Völkern für ihre medizinischen und spirituellen Eigenschaften genutzt wird).
- in Neuseeland gab es seit 2010 ein Gesetz (NZ Government Food Bill 160 – 2 vom 26.05.2010 / 22.07.2010), welches den Anbau und Verzehr von natürlichen Nahrungs-Pflanzen im eigenen Garten und auf eigenem Feld angeblich genehmigungspflichtig und kontrollpflichtig machte. Dort wurde wohl auch der Samentausch unter Gartenfreunden verboten. Nach verschiedensten Protesten wurde das Gesetz durch das New Zealand Food Act 2014 ersetzt. Das Food Act 2014 ist ein bundesweites Gesetz, das die Regulierung von Lebensmitteln und Getränken in Neuseeland regelt.
Inhaltlicher Hinweis: Die hier dargelegten Themen stellen eine wissenschaftliche These dar und haben nicht die Funktion einer rechtlichen Beratung.
[ZP.01.11.22.TJ.2.2]