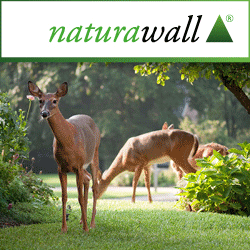Der Herbstrettich (Raphanus sativus var. longipinnatus), im ostasiatischen Raum als Daikon bekannt, ist eine späte Kulturform des Rettichs. In unserem Garten spielt sie eine wichtige Rolle für die Nachkultur im Spätsommer.
Während der klassische Sommerrettich schon im Juli geerntet wird, nutzt der Herbstrettich die verbleibende Vegetationszeit bis in den Oktober hinein. Er liefert große, feste, aber milde Wurzeln, die sich gut lagern lassen und den Speisezettel in der kühleren Jahreszeit bereichern.
Der Daikon stammt ursprünglich aus Ostasien, wo er – besonders in Japan, China und Korea – zu den wichtigsten Feldgemüsen gehört. In Mitteleuropa wurde er im 19. Jahrhundert eingeführt und ist heute unter verschiedenen Sortennamen erhältlich. Seine Anbauweise ähnelt der des Sommerrettichs, er benötigt aber eine längere Entwicklungszeit und verlangt gleichmäßige Feuchtigkeit.
Anbauanleitung
Boden und Standort
Für den Anbau des Herbstrettichs sollten wir einen sonnigen Standort wählen. Am besten gedeiht er auf tiefgründigem, lockeren und humosem Erdreich, das nicht zur Verdichtung neigt. Ein mäßig nährstoffreicher Boden mit guter Kaliumversorgung ist günstig, der einen schwach alkalisch bis neutralen pH-Wert aufweist.
Fehlt es am Spurenelement Bor, kann es zur Rissbildung und Innenbräune kommen. Auf dem Standort sollte eine Anbaupause von mindestens drei Jahren eingehalten werden, das gilt auch für andere Kreuzblütlergewächse wie Kohl und Rüben. Nur so können Krankheiten wie Kohlhernie oder Rettichschwärze vermieden werden.
Aussaat und Pflege
Die Aussaat erfolgt von Mitte Juli bis 10. August direkt ins Freiland.
Diese Zeit sollte auch eingehalten werden, denn eine zu frühe Saat führt leicht dazu, dass die Pflanzen schießen und rasch in die Blüte gehen. Eine spätere Aussaat hat zur Folge, dass keine kräftigen, ausgewachsenen Wurzeln mehr entstehen. Schon ein Aussaatzeitpunkt ab dem 1. August hat kleinere Exemplare zur Folge, und das signifikant mit jedem weiteren Tag.
Die Samen werden etwa einen Zentimeter tief, mit einem Reihenabstand von 30 bis 40 Zentimeter, gelegt. Nach dem Auflaufen wird auf einen Pflanzabstand von etwa 20 Zentimeter vereinzelt.
Eine gleichmäßige Wasserversorgung ist in der gesamten Vegetationsphase wichtig, denn unregelmäßiges Gießen oder gar Trockenheit führen zu Rissen und verholztem Gewebe.
Zur Pflege genügen mäßiges Hacken und gelegentliches Nachgießen. Eine Überdüngung – insbesondere mit frischem Mist – ist zu vermeiden, da sie die Schosserbildung begünstigt.
Ein Kulturschutznetz verhindert, dass sich Erdflöhe und Kohlfliegen, die bei warmem Wetter im Juli häufig und in Massen auftreten, über die jungen Pflanzen hermachen können. Da das Rettichlaub nicht sehr hoch wächst, genügt es, das Netz ohne Unterbau einfach über das gesamte Beet zu legen. Wird der Rand des Netzes mit Steinen oder Brettern beschwert, verhindert das das Wegwhen bei Sturm und das seitliche Eindringen der Schädlinge.
Ernte und Lagerung
Wurde Mitte Juli ausgesät, kann ab Ende September geerntet werden, sobald die Wurzeln eine ausreichende Größe erreicht haben. Wurde erst Anfang August gesät, kann die Ernte ab Mitte Oktober erfolgen.
In milden Lagen können die Rettiche noch bis November auf dem Beet bleiben, doch sollten sie vor dem ersten stärkeren Frost aufgenommen werden. Die Wurzeln lassen sich in feuchtem Sand gut im Keller oder einem kühlen Raum lagern. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt halten sie sich über den Winter hinweg frisch.
Verwendung in Küche und Vorratshaltung
Der Geschmack des Herbstrettichs ist milder als der des Winter- oder Sommerrettichs. Frisch geraspelt ergibt er eine würzige, aber nicht scharfe Beilage zu Fleisch- und Reisgerichten, oder er ergänzt einen grünen Salat mit einer erfrischenden Komponente.
Der Daikon im Kimchi und als Vorbild für den Garten
In Ostasien jedoch spielt der Daikon eine viel größere Rolle als bei uns. Er ist ein zentrales Wintergemüse, dessen Anbau eng mit der Vorratshaltung verbunden ist.
Besonders in Korea wird der späte Anbau von Rettich und Chinakohl dazu genutzt, die Felder nach der Reisernte ein zweites Mal im Jahr zu bestellen. Diese zweite Kultur liefert nicht nur frisches Gemüse für den Spätherbst, sondern zugleich die Grundlage für den Wintervorrat.
Denn im November beginnt dort die Zeit, in der Kimchi bereitet wird. Dabei wird Chinakohl und Daikon in einer scharf gewürzte Salzlake eingelegt. Die sogenannte Fermentation als Art der Haltbarmachung war über Jahrhunderte hinweg eine überlebenswichtige Methode, um den Winter zu überstehen.
So schließt sich ein wichtiger Kreis der Vorratshaltung: Der späte Anbau nutzt die letzte Wärme des Jahres, und das Gemüse wird gleich in eine haltbare Form überführt.
Dieses Prinzip, die Kombination aus intelligenter Bodennutzung und Vorratshaltung, kann auch in unserem Garten ein Vorbild sein.
Tipp für den eigenen Garten
Wer im Sommer nach der Ernte der Frühkartoffeln oder Erbsen noch Herbstrettich sät, nutzt seine Gartenfläche optimal. Die Pflanzen bedecken den Boden rasch, unterdrücken Unkraut und liefern noch im selben Jahr frisches, vitaminreiches Wurzelgemüse.
Auch wer kein Kimchi zubereiten möchte, hat mit dem mild-würzige Daikon eine wohlschmeckende Bereicherung in der winterlichen Küche – roh, gekocht oder leicht angebraten in Pfannengerichten.
Übrigens: Der „Radi“ ist der bayerische Bruder des Daikon
Auch in Mitteleuropa ist der Daikon längst heimisch geworden. So kennt man ihn in Bayern als „Radi“ (kommt von Radieschen) oder Bierrettich. Botanisch handelt es sich dabei um dieselbe Varietät (Raphanus sativus var. longipinnatus), doch haben sich regionale Formen herausgebildet, die besonders gut an das hiesige Klima angepasst sind.
Der weiße Radi wird vor allem als Rohkost serviert – spiralförmig aufgeschnitten, leicht gesalzen und zu Bier und Brezn gereicht – und ist damit eine typische Spezialität des Münchner Oktoberfestes und der bayerischen Biergärten.
Bekannte Sorten sind etwa ‘Münchner Bierrettich’, ‘Rex’ und ‘Mino Early’, allesamt Sorten mit langen, weißen, mild-würzigen Wurzeln. Während die japanischen Daikon-Sorten meist sehr gleichmäßig zylindrisch wachsen, zeigen die europäischen Radi-Sorten oft eine leicht keulenförmige Gestalt. Geschmacklich unterscheiden sie sich jedoch kaum: Beide sind saftig, knackig und angenehm mild und ideal für eine späte Ernte im Herbst.
Mehr zum "Radi" auf Inhortas.de: "Der Radi muss weinen. Der traditionelle Münchener Bier-Rettich zum Bier?"
—
[] [GJ.6.8] Gisela Jacob, 5.11.2025