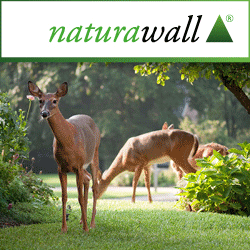Der Begriff beziehungsweise die Definition Salpeterpflanze hat sich geändert, da der Fokus heutzutage weniger auf der Gewinnung von Salpeter (Kaliumnitrat, KNO3) liegt als auf der speziellen Eigenschaft der Pflanze, Stickstoffverbindungen einlagern zu können. Im späten 19. Jahrhundert, als die Pflanzenchemie ins Interesse der Landwirtschaft rückte, wurde dieser Begriff geprägt. Heute wird diese Pflanzengruppe oft fälschlicherweise mit den sogenannten Zeigerpflanzen, die einen hohen Stickstoffgehalt im Boden aufweisen, in Verbindung gebracht.
Die Frage, warum einige Pflanzen Stickstoffverbindungen einlagern können und somit einen hohen Stickstoffgehalt aufweisen, scheint die Wissenschaft heute kaum noch zu interessieren. Trotzdem profitieren all jene Gartenfreunde, die um alternative Gartenmethoden wissen und sie anwenden, von diesem Phänomen. Mittlerweile wieder gut bekannt ist die Erkenntnis, dass Brennnesseljauche ein guter Stickstoffdünger ist. Warum das so ist, wissen die wenigsten.
Doch tatsächlich ist es so, dass die Brennnesseln, im Bild 2) zu sehen, sehr stickstoffhaltig sind. In ältesten Aufzeichnungen ist die Information zu finden, dass diese Pflanze in der Lage ist, Salpeter Kaliumnitrat (KNO3) in den Zellen ihrer Blätter einzulagern. Um 1900 [3] war bereits bekannt, dass neben sehr verschiedenen Stickstoffverbindungen zum Beispiel auch Ammoniak (NH3) und Salpetersäure (HNO3) in den Pflanzenteilen eingelagert sind und das Ammoniak vermutlich in Form von phosphorsaurem Ammonium-Magnesium. Diese Einlagerungen haben aber nichts mit den stickstoffsammelnden Leguminosen zu tun, welche in einer Symbiose mit Knöllchenbakterien Luftstickstoff pflanzenverfügbar machen.
 2) Die Brennnessel, zu Unrecht als Unkraut gescholten.
2) Die Brennnessel, zu Unrecht als Unkraut gescholten.
Die vermutlich letzte Erwähnung der Salpeterpflanzen fand ich in einer Schrift über gartenbauliches Grundlagenwissen [1] aus dem Jahre 1942, und je weiter ich die Thematik, zeitlich zurückgehend, verfolgte, finden sich Hinweise auf die stickstoffsammelnden Pflanzenarten. Meine derzeitige Liste dieser Stickstoffpflanzen ist hier zusammengestellt:
- Anchusa officinalis – Gemeine Ochsenzunge (nach Müller [2])
- Beta vulgaris subsp. vulgaris – Runkelrübe (nach Müller [2])
- Beta vulgaris subsp. vulgaris, Crassa-Gruppe – Futterrübe; sehr hoher Stickstoff-Anteil, bis 0,3% (nach König [3])
- Beta vulgaris – die Art
- Cucurbita – Kürbisarten (nach Müller [2])
- Eispflanze – (nach Müller [2])
- Fumaria – Erdrauch, eine Pflanzengattung der Unterfamilie der Erdrauchgewächse (Fumarioideae) aus der Familie der Mohngewächse (Papaveraceae) (nach Müller [2])
- Gramineae – Süßgräser; nach König [3] bis zu 0,1% in den grünen Pflanzen (nicht im Samen)
- Helianthus annuus – Sonnenblume (nach Müller [2])
- Helianthus-Arten – (nach Müller [2])
- Leguminosen – (nach König [3]) bis zu 0,1% in den grünen Pflanzen (nicht im Samen)
- Nicotiana – Tabak; neben dem Flaschenkürbis die älteste Kulturpflanze der Menschheit
- Solanum tuberosum – Kartoffeln (nach Müller [2])
- Urtica –Brennnesseln (nach [1] und Müller [2])
Hoher Stickstoffgehalt in Futterrüben
Prof. Dr. J. König (Geheimer Regierungs-Rath, o. Professor an der Kgl. Universität und Vorsteher der agric.-chem. Versuchsstation Münster i.W.) hebt in seinem Buch [3] den besonders hohen Gehalt an Ammoniak und Salpetersäure [beides Stickstoffverbindungen] hervor: "Sehr bedeutend [...] kann der Salpetergehalt in den Rübensorten werden [womit sicher Beta vulgaris subsp. vulgaris gemeint ist]."
 3) Rote Bete und Futterrüben sind Salpeterpflanzen.
3) Rote Bete und Futterrüben sind Salpeterpflanzen.
In der Trockensubstanz der Runkelrüben fand man bis zu 3,49% Salpetersäure; im Rübensaft 0,013 bis 0,285% Salpetersäure und 0,0063 bis 0,0258% Ammoniak. Zuckerrüben sollen 0,324 bis 0,926% Salpetersäure enthalten; König bemerkt jedoch: "Dieselbe nimmt mit dem Reifend der Pflanzen ab" und vermutet, dass das "Ammoniak in den Pflanzen in Form von phosphorsaurem Ammonium-Magnesium vorhanden ist." ([3] S. 94) Zu erwähnen ist, dass zu der Art Beta vulgaris subsp. vulgaris auch die verschiedenen Sorten von Mangold und der Roten Rüben gehören.
Fazit
Dass einige Pflanzenarten Stickstoff einlagern können, ist zunächst eine interessante Tatsache. Bemerkenswert ist aber auch, dass unter diesen etliche Kulturpflanzen der Neuen Welt sind, wie beispielsweise Kürbis, Kartoffeln, Tabak und Helianthus. Ob diese Stickstoffpflanzen den Stickstoffkreislauf im Pflanzenbau im Zusammenhang mit einer besonderen Kultur ergänzen, bliebe noch zu ergründen. Wie schon erwähnt, wird der Salpeter bereits durch die Verarbeitung von Pflanzenmaterial (Brennnesseln und andere Kräuter) zu Jauche freigesetzt und kann so als Dünger verwendet werden.
Hier wäre natürlich zu ergründen, ob und bis zu welchem Stadium die Stickstoffverbindungen im Wasser einer Brennnesseljauche aufgeschlossen werden und ihre Dungkraft entfalten können, oder ob es besser ist, die Stickstoffpflanzen dem Kompost zuzuführen. Meine Vermutung ist, da Salpeter (Kaliumnitrat) und phosphorsaures Ammonium-Magnesium bereits Erwähnung fanden, dass der Pflanzennährstoff Stickstoff in den Salpeterpflanzen gebunden mit anderen wichtigen Nährstoffen, wie Phosphor, Magnesium und Kalium vorkommt und dieser besondere Mix die Brennnesseljauche so effektiv macht.
 4) Der Mangold ist eine Variante der Runkelrübe Beta vulgaris subsp. vulgaris.
4) Der Mangold ist eine Variante der Runkelrübe Beta vulgaris subsp. vulgaris.
- [1] Oberkommando der Wehrmacht; Der Kleingarten, landwirtschaftlicher Sonderlehrgang; 1. Teil, 41. Sammelband der Schriftreihe "Soldatenbriefe zur Berufsförderung"; Frankfurt/Oder 1942; Seite125
- [2] Müller, Gottfried Ludwig Carl; Müllers chemisch technische Abhandlungen, Band 2; Anleitung zur Erzeugung, Gewinnung und Bearbeitung des Salpeters; Regensburg 1829
- [3] König, Prof. Dr. J.; Die menschlichen Nahrungs- und Genussmittel, ihre Herstellung, Zusammensetzung und Beschaffenheit, nebst einem Abriss über die Ernährungslehre; Berlin 1904 (Seite 90ff) [Ältere Auflage Berlin/Heidelberg 1883]; Solanin und Solanein in der Kartoffel: Knollen 0,032 bis 0,068%, Schalen 0,24% und in den Keimen