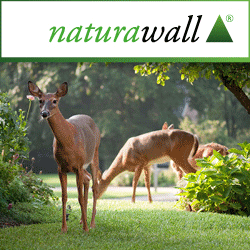🍂🌞 Der Herbst mit seinem Feuerwerk an Farben, seinen wechselnden Naturstimmungen und der Vorahnung auf den Winter weckt in vielen von uns die Sehnsucht nach romantischen Worten und Versen. Da wundert es nicht, warum Herbstgedichte so beliebt sind. Nicht zuletzt gehört das Auswendiglernen von Gedichten zu unserer Kultur und wird in den Schulen praktiziert. Ein besonders heimeliges, vielleicht auch ein wenig erotisches Gedicht stammt von Johannes Schlaf.
Die zwei Verse werden mit den Worten eingeleitet: Herbstsonnenschein, der liebe Abend lacht so still herein... Sofort beginnt unsere Phantasie ihr Bild zu malen, eine herbstliche Stimmung vielleicht an einem ruhigen und freundlichen Oktoberabend. Ein Feuerlein rot knistert im Ofenloch und loht [brennt].
Und weiter eröffnet sich uns ein Bild der Ruhe und Entspannung. Es ist so still, keine Hektik, kein Lärm, und wir lassen uns darauf ein und lauschen dem Knistern im Ofen. Das kurze Gedicht führt uns weiter in eine rein emotionale Welt, und am Ende geht es dann doch um das Zeitgefühl und ein Verständnis der Zeit.
Denn den Versen stellte der Dichter folgende romantische Einleitung voran: Da wollen wir beieinander sitzen in Herbstmonddämmer hinein und leise verlorene Worte plaudern. —
Herbst
2.
Herbstsonnenschein.
Der liebe Abend lacht so still herein.
Ein Feuerlein rot
Knistert im Ofenloch und loht.
So! – Mein Kopf auf deinen Knie'n. —
So ist mir gut;
Wenn mein Auge so in deinem ruht.
Wie leis die Minuten ziehn! ...
Johannes Schlaf
Man merkt schnell, dass es sich nicht nur um ein Herbst-, sondern zugleich auch um ein Liebesgedicht handelt. Es stammt aus der Feder des deutschen Dramatikers und Erzählers Johannes Schlaf (1862 – 1941). Schlaf gehörte seinerzeit der Strömung des Naturalismus an und gilt als einer seiner wichtigsten Vertreter. Vorliegendes Werk veröffentlichte der Dichter in der Sammlung "Helldunkel".
Eingangs sprach ich zwar von einem kurzen Herbstgedicht, aber genau genommen sind die Zeilen nur der zweite Teil des Gedichts "Herbst", wobei beide Teile durchaus für sich stehen können.
Herbst
1.
Nun kommen die letzten klaren Tage
Einer müderen Sonne.
Bunttaumelnde Pracht,
Blatt bei Blatt.
So heimisch raschelt
Der Fuß durchs Laub.
O du liebes, weitstilles Farbendlied!
Du zarte, umrißreine Wonne!
Komm!
Ein letztes Sonneblickchen
Wärmt unser Heim.
Da wollen wir sitzen,
Still im Stillen,
Und in die müden Abendfarben sehn.
Da wollen wir beieinander sitzen
In Herbstmonddämmer hinein
Und leise
Verlorene Worte plaudern. —
Interpretationen
Die Zeit im Herbstgedicht von Johannes Schlaf
Wer den Sinn dieses Herbstgedichts einmal verinnerlicht hat, wird immer wieder zu ihm finden, denn es spricht mehr als nur das Gefühl an. Dem Dichter geht es auch um das Phänomen der Zeit. Wenn wir ihren Takt und Kreislauf rational erfassen wollen, müssen wir sie zuvor auch emotional erfassen. Dazu braucht es Ruhe. Johannes Schlaf beschreibt es sehr deutlich: Da wollen wir sitzen, still im Stillen, und in die müden Abendfarben sehn. Diese Ruhe meint das Nicht-Tätigsein, die schweigende, sowohl akustische als auch optische Geräuschlosigkeit, die uns das dichterisch gemalte Herbstbild zuteilwerden lässt.
In diesem Zustand kann es sein, dass wir Momente der Zeitlosigkeit genießen. Finden wir dann langsam wieder in die Wirklichkeit zurück, beginnt – anfangs noch recht ruhig – der Puls der Zeit wieder zu schlagen. In diesem Pulsieren bemerken wir vielleicht, was Zeit in Tiefe, Länge und Rhythmus bedeuten kann.
 Goldenes Herbstlaub vom Efeuwein
Goldenes Herbstlaub vom Efeuwein
Vom Biedermeier zur Industrialisierung – veränderte Zeitrhythmen
Johannes Schlaf romantisiert sicher dieses Vermögen des produktiven Nichtstuns – auch deshalb, weil er in einer Welt groß wurde, in der der alte, an den Jahreskreis gebundene Lebensrhythmus schon einige Jahrzehnte der Vergangenheit angehörte. Jene „guten alten“ Tage waren die beschauliche Biedermeierzeit, die mit der Erfindung der Dampfmaschine ein jähes Ende fand.
Im Jahre 1829 entwickelte der Engländer Stephenson die erste brauchbare Lokomotive, die schwere Lasten mit hoher Geschwindigkeit ziehen konnte. Bereits sechs Jahre später, also 1835, wurde die erste deutsche Dampfbahn auf der Kurzstrecke Nürnberg–Fürth für den Verkehr freigegeben. Daraufhin folgte 1839 in Sachsen der Bau der ersten großen Bahnstrecke Deutschlands, der Linie Leipzig–Dresden. Bis zum Geburtsjahr des Dichters gab es in Deutschland Bahnstationen in jeder größeren Stadt und auch schon vielerorts auf dem Land.
Mit dem Fahrplan der Eisenbahn lebten die Menschen nun im Takt der Minuten und nicht mehr im Takt der Stunden, Tage und des Jahreskreises. Trotz der mittlerweile verbreiteten Erkenntnis, dass diese Entwicklung dem Wohlbefinden des Menschen nicht guttut, hat sich daran nichts geändert. Im Gegenteil.
Doch die meisten von uns fühlen, so wie Johannes Schlaf damals schon, dass wir eine Spezies sind, die eigentlich nicht in diese Welt des Minutentakts gehört. Situationen wie die in diesem Herbstgedicht beschriebenen erscheinen daher eher als Fantasie und als Ausdruck eines gewissen Nachtrauens an eine „gute alte Zeit“. Aber das muss nicht so sein.
Warum wir nicht im Minutentakt leben sollten
In meinen Publikationen Immerwährender Gartenkalender gehe ich regelmäßig auch auf die realistischen Möglichkeiten ein, unseren „artgerechten“ Lebensrhythmus wiederzufinden. Diese Kalender, die genau genommen als Gartentagebuch genutzt werden sollten und in erster Linie nützliches Gärtnerwissen vermitteln, haben jeweils am Ende eine eher philosophische „Nachlese“.
Im Band Nr. 2 (Herbstanbau von Gemüse) geht es explizit um eine andere Zeitrechnung, in der das Jahr den Tag ersetzt. Und der Herbst wird besonders in Augenschein genommen – mit der Eigentümlichkeit, dass unsere Altvorderen den Herbst als eigenständige Jahreszeit gar nicht kannten. Für die Landbevölkerung gab es nur Frühling, Sommer und Winter (spring, summer, winter), wobei der Sommer zum Martinstag endete. Bis dahin zeigt sich nach den Hochsommertagen immer wieder ein wellenartiges Auflodern warmer, sonniger Tage, die jedoch kürzer werden, bis sie schließlich ganz erlöschen.
Gärtnern als Rückkehr zum natürlichen Lebensrhythmus
Das Gärtnern kann durchaus eine Hilfe sein, diesen Rhythmus wiederzufinden, der tatsächlich eng mit dem bäuerlichen Wirtschaftsjahr verbunden ist. Doch auch für jene, die sich nach diesen alten Daseinszyklen sehnen und keinen Garten besitzen, gibt es in meinem Immerwährenden Garten- und Naturkalender Band Nr. 4 – Selbstversorgung ohne Garten viele Anregungen und Möglichkeiten, neue Pfade zu betreten.
Hinweise, Quellen, Literatur
Schlaf, Johannes; Helldunkel [Gedichte]; Minden in Westf. 1899
Jacob, Thomas; Immerwährender Gartenkalender Band Nr. 2 – Herbstanbau von Gemüse, Dohna 2021
Jacob, Gisela und Thomas; Immerwährender Garten- und Naturkalender Band Nr. 4 – Selbstversorgung ohne Garten, Dohna 2022
hier zu den vorgestellten Buchtiteln
—
🍁 [GJ.5.16] G. Jacob, 27.12.2013; 17.9.2022