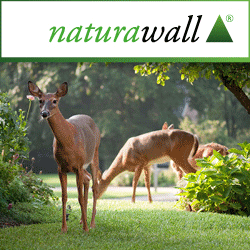Die Lyra, die antike Harfe, ist ein Symbol für die Lied- oder Dichtkunst. Leitet sich davon ja auch der Begriff Lyrik, also die Dichtkunst, ab, welche ursprünglich mit einer Begleitung durch die Lyra vorgetragen wurde. Zugleich steht die Lyra auch für den Tanz, denn sie ist auch das Attribut der Musen Erato und Terpsichore, die Musen des Gesanges und Tanzes. Des Weiteren steht die Lyra mit ihrer symmetrischen Grundform für die Harmonie als philosophisches Grundkonzept.
Lyra und Tetrachord
Eine Lyra, wie sie, sehr zurückhaltend in Jurakalkstein graviert, im Bild 2) zu sehen ist, wurde für diesen Fall mit fünf Saiten stilisiert. Die klassische Lyra besitzt sieben Saiten. Hat sie jedoch nur vier Saiten, wird sie als Tetrachord bezeichnet.
Bei den Neuplatonikern (Proclus Lycaeus, 412 bis 485) ist die viersaitige Lyra (Tetrachord) Symbol für des Feuer und für die Luft und für das Flüchtige, doch je nach Zusammenhang, in dem sie steht, ist sie auch ein dualistisches Symbol für Wasser (Bewegung) und Erde (Unbeweglichkeit, Dichte und Schwerfälligkeit).
Auf den ersten Blick scheint uns diese Auslegung etwas weithergeholt, doch das Geheimnis der Symbolik, welche sich um die Lyra rankt, ist vielschichtiger als wir denken, denn die Lyra und die Gesetzte der Harmonielehren der Musik überhaupt, war für die Platoniker ein Symbol der Harmonie innerhalb des Kosmos, also der Gegenkraft des Chaos.
Unter dem Wort Harmonie, welches besser mit Ebenmaß (altgriechisch ἁρμονία harmonía) zu übersetzten ist, verstand man im eigentlichen Sinn die Vereinigung zweier Gegensätze zu einer Ganzheit, zu einer Symmetrie (Lyra mit symmetrischer Form!) und Harmonie. Bei letzterem Begriff verkörpert die indogermanische Silbe ar bzw. har linguistisch diesen Sinn. Mit dem Begriff Harmonie sind wir wiederum auch ganz nahe bei dem Ursinn der Religion, lateinisch religio, was so viel wie Rück-Legierung, also Rückbindung bedeutet. Und das heißt nichts anderes als im Einklang mit der Natur und ihrer Spiritualität zu leben.
Doch machen wir zunächst noch einen Exkurs in die alte griechische Mythologie, von der die Lyra, als Attribut verschiedener Götter und Heroen, abgeleitet ist.
 2) Die Lyra - Sinnbild auf einem Grabstein eines Kirchenmusikers.
2) Die Lyra - Sinnbild auf einem Grabstein eines Kirchenmusikers.
Die Lyra in den griechischen Mythen
Apollon und die Musen
Die Schutzgöttinnen der Künste sind die neun Musen. Ihr Attribut ist in den Darstellungen oft die Lyra. Eine von ihnen, Kalliope, die Mutter des Orpheus, wurde sehr oft mit diesem Saiteninstrument abgebildet.
Erato und Terpsichore sind Musen des Gesanges und des Tanzes. Im Bild 3) sind sie, beide - links und Mitte - mit Lyra, zusammen mit Apollon - ganz rechts - (Geliebter der Muse Terpsichore) abgebildet. Apollon trägt das Saiteninstrument ebenfalls als Attribut, denn er ist der Gott der Künste Musik, Dichtkunst und Gesang. Der Neuplatoniker Salustios (ein spätantiker Philosoph) sieht in dieser Symbolik den Apollon, der die Saiten der Lyra stimmt, als eine überkosmische Kraft (Gesetzmäßigkeit) einer harmonischen Weltordnung, die den Kosmos bewahrt.
Doch Apollon ist auch die Gottheit der Mäßigung und des Lichtes, wobei die Mäßigung, das Maß halten und das Einsichtüben einen Teilaspekt der Lyra-Symbolik darstellt. Aber auch der bereits erwähnte Orpheus ist ein Gegner der Maßlosigkeit und ein Gegenspieler des ekstatischen Dionysos.
 3) Vasenbild, auf dem Erato, Terpsichore und Apollon jeweils mit Lyra dargestellt sind.
3) Vasenbild, auf dem Erato, Terpsichore und Apollon jeweils mit Lyra dargestellt sind.
Orpheus und weitere griechische Götter
Die Lyra ist nicht nur das Attribut und Kennzeichen verschiedener griechischer Götter, sondern findet nicht selten auch in der Neuzeit Verwendung. Dass sie zur Grabmalsymbolik gehört und man sie oft auf Grabmälern findet, wie auf den Bildern 1) und 2) zu sehen, hat sicher auch mit der Geschichte von Orpheus und Eurydike zu tun.
Deren Beziehung zur Welt der Toten ist später sogar im christlichen Sinne interpretiert worden. Tatsächlich finden sich in der alten Katakombenkunst sowohl Orpheus- als auch Christusdarstellungen mit Lyra. Auf dem Bild 4) finden wir die Lyra im Zusammenhang mit dem Tod: Orpheus, Sohn der Muse Kalliope, wird von einer thrakischen Verehrerin (röm. Baccantin) des Gottes Dionysos getötet.
Das Saiteninstrument findet sich weiterhin bei der Göttin der Harmonie Harmonia oder im Zusammenhang mit dem Windgott Aiolos (Aeolus, Äolus) und wird bei letzterem als Äolsharfe bezeichnet. Heutigentags findet die Äolsharfe als akustisches Gestaltungselement in der Gartengestaltung Verwendung. Anleitungen zum Bau solch einfacher Instrumente gibt es in vielerlei Ausführungen im Internet.
 4) Tod des Orpheus, der mit Lyra dargestellt ist.
4) Tod des Orpheus, der mit Lyra dargestellt ist.
Hermes, der Erfinder der Lyra
Nahe dem Mythos über den griechischen Windgott Aiolos ist auch die Legende des Götterboten Hermes angesiedelt, der in seinem Ursprung vermutlich selber eine Gottheit der Winde und Lüfte war. Er gilt zudem als der Erfinder der Lyra. Als gerade mal Neugeborener beförderte er, nachdem er aus seiner Wiege geklettert war, sogleich eine Schildkröte vom Leben zum Tode. Aus deren Panzer fertigte er dann die erste Lyra an, indem er sie mit Fell bespannte und Saiten daran befestigte.
Dieses Musikinstrument ist auch in seiner Urform recht archaisch, denn es bestand tatsächlich ursprünglich aus einem mit Kuhhaut überzogenen Schildkrötenpanzer, oder Tierschädel dienten als Resonanzkörper.
Übrigens stahl der junge Hermes am selben Tag auch noch Kühe aus der Kuhherde des Apollon, wobei er von diesem allerdings gestellt wurde. Zur Sühne schenkte er Apollon seine selbstgebaute Lyra. Apollon nahm die Angelegenheit nicht übel und schenkte dem jungen Gott einen goldenen Heroldsstab. Dieser, auch Hermesstab genannt, ist wiederum selber ein im Wesen ähnliches Symbol. Die zwei sich um den Stab windenden Schlangen (am Hermesstab) stellen den Ausgleich der Dualitäten dar und sind so ein Sinnbild der Harmonie.
Weitere Bedeutungen, Berufssymbole
Die Lyra galt im Mittelalter als königliches Instrument, weil der alttestamentliche König David (Vater des Salomo), der Verfasser zahlreicher biblischer Psalmen, diese beim Vortragen mit der Harfe begleitete. Deshalb ist dieses Instrument auch ein Bild für Feierlichkeit und Besinnlichkeit.
 5) Harfe, Buch, Pinsel und Schreibfeder als Berufssymbol für einen Künstler bzw. für die bildenden Künste.
5) Harfe, Buch, Pinsel und Schreibfeder als Berufssymbol für einen Künstler bzw. für die bildenden Künste.
Die Harfe als Traumsymbol
Mitunter hat sie auch die Bedeutung als Traumsymbol. Die Bedeutung von Musik im Traum wird dadurch gedeutet, welche Stimmung sie auf den Träumenden ausübt.
Die Harfe im Traum kann wegen ihrer "weiblichen" Form auch sexuelle Bedeutung haben.
 6) Eine Grabplatte aus Bronze mit der Abbildung einer trauernden Genie.
6) Eine Grabplatte aus Bronze mit der Abbildung einer trauernden Genie.
Zum Schluss haben wir noch eine interessante Darstellung, zu sehen in Bild 6), auf einer Grabbronzeplatte zur Betrachtung, worauf eine trauernde Genie zu sehen ist. Sitzend hat sie ihr Gesicht mit dem linken Arm bedeckt und auf einem, mit einem Tuch verhüllen Altar, aufgestützt. Mit dem rechten Arm hält sie sich hinter ihrem Körper an einem vergabelten Baum fest, dessen Gabelung einer Lyra ähnelt, und tatsächlich finden sich an diesem Baum sechs Saiten gespannt, und symbolisieren als Gesamtkonzept eine Lyra beziehungsweise Harfe. Es ist ein schönes Bild der Hamonie mit der Natur, wobei verhüllte Formen Dinge symbolisieren, die wir hier auf dieser Welt noch nicht in ihrer Vollendung sehen können.