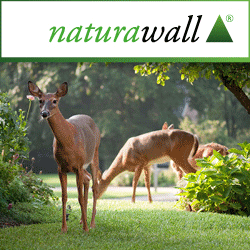Ein Garten gilt vielerorts als nahezu unverzichtbarer Bestandteil einer Wohnstätte. Für das japanische Wohnhaus jedoch besitzt diese Verbindung eine ganz besondere Intensität. Ohne Garten ist es kaum denkbar. Das Haus öffnet sich über die Veranda, die tief herabgezogenen Dachvorsprünge, über Steinstufen und Trittsteine hinweg und verschmilzt mit dem Garten zu einer harmonischen Einheit. Zwischen Architektur und Natur besteht folglich kaum eine Grenze.
Zwei Besonderheiten vorweg
Bevor ich näher auf die Eigenarten der alten japanischen Bauweise eingehe, sei zweierlei betont: Erstens prägt das Klima die Architektur in erheblichem Maße. Die mittleren Temperaturen in Tokio entsprechen etwa denen in London, doch die hohe Luftfeuchtigkeit macht den Sommer ungleich schwüler und drückender als in Europa.
Der Winter hingegen bringt eine trockene Kälte, die leichter zu ertragen ist als das häufig nasskalte Wetter unserer Breiten. Daraus erklärt sich auch die Bauweise: Traditionelle Häuser besitzen breite Fenster- und Türöffnungen, die im Sommer eine kontinuierliche Querlüftung ermöglichen, im Winter jedoch nur geringen Heizkomfort bieten.
Zweitens greifen neben klimatischen Faktoren – und selbstverständlich auch den häufigen Erdbeben – geistige Prägungen tief in die Baukultur ein. Besonders der Buddhismus hat seine Spuren hinterlassen. Er vermittelt die Vorstellung von der Vergänglichkeit allen Lebens und dass die Welt letztlich nur eine provisorische Herberge sei.
Tetsuro Yoshida scheibt weiterhin an anderer Stelle: "Matsou Basho (1644 – 1694), der große Haiku-Dichter, hat an seine Dichter-Kollegen Worte gerichtet, in denen es heißt, dass man nie die von den Alten überlieferten Formen nachahmen solle, sondern dem nachstreben, was die Alten erstrebten. Dies bezog sich auf die Haiku-Dichtung, aber gilt auch für die Baukunst." [1]
Gliederung der Häuser
In Japan wurde seit dem 16. Jahrhundert das traditionelle Wohnhaus in seiner Gliederung, im Aufbau und in der Raumgestaltung stark von der buddhistischen Lebenshaltung beeinflusst. Man versuchte, das alltägliche Leben in das Walten der Natur einzubinden, und man fühlte sich weniger als Beherrscher der Natur. Man ordnete sich der Natur unter oder besser: man ordnete sich ein.
Daher resultiert die einfache Bauweise der Häuser und deren minimalistische Einrichtung. Diese Vorzüge bestehen nach Tetsuro Yoshida im Wesentlichen durch den Einzelstand des Hauses im Garten und dass zwischen Haus und Umgebung eine innige Beziehung besteht, indem Hausinneres und Garten zu einem Ganzen verschmolzen sind:
- in der Schaffung vieler großer Tür- und Festeröffnungen als Anpassung an das besondere Klima
- in der vielseitigen Nutzung der Räume; jeder allgemeine Raum kann z.B. auch als Schlafraum genutzt werden
- in der sachlichen und rationalistischen Baugestaltung und Übereinstimmung von Konstruktion und architektonischer Schönheit
- in einfachster, klarer und reinster Raumgestaltung mit Tokonama (Bildnische) als optischem Mittelpunkt
- in Verwendung ungestrichener Hölzer mit schöner Maserung, Vermeidung spiegelnder Materialien
- in praktisch eingebauten Wandmöbeln, die einen "ausgedehnten Flächeneindruck" hinterlassen
- in der Normung der Zimmergrößen, Bauteile und Proportionen bis in die kleinsten Einzelheiten. Ein wichtiges Grundmaß bilden die genormten Bodenmatten der Zimmer.
Die Gartenmauer als äußere Begrenzung
Das japanische Wohnhaus steht in aller Regel nicht unmittelbar an der Straße, sondern eingebettet in einen Garten. Dieser wird durch eine Einfriedung gefasst – häufig ein hoher Bretter- oder Bambuszaun, eine streng geschnittene immergrüne Hecke oder, seltener, eine Steinmauer. Diese Umgrenzung übernimmt die Funktion einer eigentlichen Außenwand. Da das japanische Haus durch seine offene Bauweise kaum geschlossene Fassaden kennt, bildet die Gartenmauer den Schutzraum nach außen. Über sie hinweg ragt das frische Grün der Bäume, und zwischen den Kronen schimmern allenfalls die Dächer der Wohnhäuser hervor.
 Von hohen Einfriedungen umgebener Hof
Von hohen Einfriedungen umgebener Hof
Der Zugang zum Haus
Von der Gartenpforte führt der Weg nicht geradlinig zum Eingang. Ein gepflasterter Steig oder eine Abfolge von Trittsteinen windet sich in sanften Kurven oder schräg durch den Vordergarten bis zur Haustür. Diese Anordnung folgt einer klaren Absicht: Der Zugang bleibt der direkten Einsicht von der Straße entzogen und vermittelt dem Eintretenden bereits ein erstes Gefühl von Intimität und Übergang.
Der Hauptgarten
Im Sichtfeld des Empfangs- oder Wohnzimmers liegt in der Regel der Hauptgarten. Er nimmt den größten Teil der Außenfläche ein und ist in seiner Gestaltung abhängig von Größe und Bodenbeschaffenheit des Grundstücks. Der traditionelle japanische Garten jedoch ist nicht primär Nutzfläche, sondern ein künstlerisch komponiertes Landschaftsbild, das der kontemplativen Betrachtung dient. Praktische Zwecke treten deutlich zurück.
Natürlich handelt es sich hierbei um ein Ideal. Auf Okinawa etwa, wo heute viele Hundertjährige leben, finden sich einfache japanische Häuser, die eher an unsere Bungalows erinnern. Ihre Gärten sind oftmals von Gemüsebeeten geprägt – zweckmäßig, bodenständig und weniger von ästhetischer Inszenierung bestimmt.
Abweichungen von der klassischen Form sind also zahlreich. Was hier beschrieben wird, soll daher nicht als starres Muster gelten, sondern als Anregung und Hinweis auf die Grundideen des japanischen Wohnens.
Was lässt sich übernehmen?
Dass ich hier ausführlicher über den Garten spreche als über das Haus selbst, liegt daran, dass wir in unseren Breiten vieles vom japanischen Wohnstil nur schwerlich übernehmen können. Ein Beispiel dafür sind die Tatami-Matten. Diese etwa sechs Zentimeter starken Bodenmatten mit Schonbezug bilden den eigentlichen Belag der Zimmer.
Ergänzt werden sie durch Sitzkissen und Schlafmatten, die bei Nichtgebrauch im Wandschrank verschwinden. Sie ermöglichen es erst, auf dem Boden zu sitzen oder zu schlafen.
Darüber hinaus ist der gesamte Bau des Hauses auf das Raster dieser Matten abgestimmt. Solche Räume betritt man ausschließlich mit Strümpfen. Die typische Raumwirkung – die klaren Perspektiven und Sichtachsen in den Garten – entfaltet sich zudem erst dann, wenn man selbst auf dem Boden sitzt und den Ausblick in Ruhe betrachtet.
Wird von diesen Gepflogenheiten abgewichen, indem man etwa Dielen mit dünnen Naturmatten belegt und Stühle aufstellt, so verliert das architektonische Gesamtkonzept seine innere Logik.
Parallelen im Westen
Tetsuro Yoshida weist in seinem Buch darauf hin, dass gewisse Ähnlichkeiten zwischen japanischen Wohnhäusern und englischen Landhäusern bestehen. Auch die Cottages stehen frei inmitten von Gärten. Von den viktorianischen Varianten kennen wir zudem die Veranden (Folk Victorian).
Vielleicht noch näher stehen ihnen die gemütlichen amerikanischen Holzhäuser – wie etwa das American Foursquare – mit ihren charakteristischen, einladenden Porches. Diese Beispiele mögen als Anregungen für die Suche nach einer eigenständigen, westlich geprägten Lösung dienen.
Eine pragmatische Alternative
Es gibt jedoch eine einfachere Möglichkeit, japanische Wohnkultur aufzugreifen. Viele moderne Japaner leben heute in europäisch eingerichteten Häusern, behalten jedoch einen Teil der Wohnung in traditioneller Gestaltung bei.
Für uns bietet sich in ähnlicher Weise an, zunächst einen Teeraum zu schaffen – sei es als separates Teehäuschen im Garten oder als integrierter Raum im Wohnhaus. Auf diese Weise lässt sich die Atmosphäre japanischer Wohnkunst mit den Gegebenheiten unserer Kultur in Einklang bringen.
Literatur & Quellen:
- [1] Tetsuro Yoshida: DAS JAPANISCHE WOHNHAUS. Tübingen 1954.
- Taut, Bruno: Das japanische Haus und sein Leben. Berlin 1997.
- Taut, Bruno: Ich liebe die japanische Kultur. Kleine Schriften über Japan. Herausgegeben v. Manfred Speidel, Berlin 2003.
🔸 [TJ.33.5] Thomas Jacob, 19.5.2015