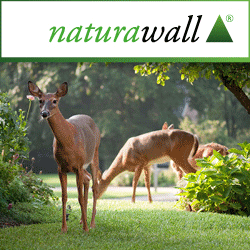Das Bleichen von Gemüsen bewirkt ein Dicken- und Streckungswachstum von Stängel- und Blattrippenorganen und senkt den Bitterstoffgehalt in den Pflanzen. Der Fachbegriff für diese besondere Kultur ist Etiolieren bzw. Etiolemént*. Jedoch möchte ich die Bleichkultur hier an dieser Stelle weniger wissenschaftlich erläutern, sondern vielmehr unsere Aufmerksamkeit auf die Anwendungsmöglichkeiten im Selbstversorgergarten lenken.
Erklärung
Pflanzen sind Sonnenanbeter, sie streben zum Licht, um mit dem in ihren Blättern enthaltenen Chlorophyll (das die Grünfärbung bewirkt) Zuckermoleküle zu bilden. Diese Glucose wird dann unter Zuhilfenahme von Mineralstoffen weiterverarbeitet und zwar zu Kohlenhydraten, Fetten, Eiweißen und den verschiedensten anderen organischen Stoffen, welche die Pflanze zur Existenz und Fortpflanzung benötigt.
Für all diese lebenswichtigen Stoffwechselvorgänge braucht die Pflanze das Licht. Wenn nun aber zum Beispiel am Rande eines Wasserlaufes eine Blattstaude durch eine Überschwemmung mit Erde bedeckt wird, steht sie mit einem Male in völlig umgestalteter Umgebung und in absoluter Finsternis. Genau genommen bedeutet das den Tod der Pflanze. Nun hat aber die Natur diese Staude mit einer Art Reflex ausgestattet, der es ihr ermöglicht, sich mit dieser misslichen Lage nicht abzufinden, sondern mit aller Macht zu versuchen, irgendwie das rettende Licht doch noch zu erreichen.
Das Gewächs sammelt also alle seine vorhandenen Speicherstoffe und leitet sie in die Ausbildung kräftiger Sprosse und Blattadern. Mit diesen kräftigen Pflanzenorganen, die jedoch mangels Licht kein Chlorophyll mehr bilden und deshalb bleich erscheinen (man spricht in diesem Zusammenhang auch vom Vergeilen), schiebt sich die Staude nun, der Schwerkraft entgegen, zum Licht. Ist sie mit ihren langgestreckten Pflanzenorganen dort angekommen, nehmen diese sofort wieder ihre alte, grazilere Form an. Unter der Wirkung des Sonnenlichtes werden die Stängel dünner, und die Blätter bekommen größere Blattflächen und zartere Blattadern und können wieder das lebensrettende Chlorophyll in ihren Laub- und Gerüstorganen bilden und speichern.
 2) Knollenfenchel ist ein typisches Bleichgemüse. Das Herz wird mit Erde abgedeckt und wird dadurch größer und milder.
2) Knollenfenchel ist ein typisches Bleichgemüse. Das Herz wird mit Erde abgedeckt und wird dadurch größer und milder.
Jeder Gartenfreund hat sicher schon einmal die Beobachtung gemacht, dass ein Gegenstand wie eine Wassertonne, ein Schwimmbassin oder ein Gartenmöbel auf einer Rasenfläche gelbes Gras hinterlässt, wenn er wieder entfernt wird. Bei genauerem Hinschauen, wird man erkennen, dass die abgedeckten Pflanzen nicht nur gelb sondern auch dicker geworden sind. Bei Gras ist das weniger auffällig, aber Stauden reagieren relativ schnell mit diesem Phänomen. Diese Beobachtung haben wohl einmal Gärtner beim Spargelanbau gemacht und festgestellt, dass der Teil des Spargels, der noch nicht die Erdoberfläche erreicht hat, gut die doppelte Dicke besitzt zu den Teilen, die bereits dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. So kamen sie auf die pfiffige Idee, die Spargel-Treiblinge anzuhäufeln, um mehr Längenwachstum des unterirdischen, dickeren Sprosses zu erhalten. Zugleich machte man die Erfahrung, dass die bleichen Pflanzenteile milder im Geschmack sind. Offensichtlich werden viele Bitterstoffe in den Pflanzen erst durch das Sonnenlicht gebildet und eingelagert.
 3) Die Porreestangen stehen im Juli noch in einer vertieften Rille, die nun verfüllt und später zum Damm aufgeschüttet wird.
3) Die Porreestangen stehen im Juli noch in einer vertieften Rille, die nun verfüllt und später zum Damm aufgeschüttet wird.
Auf diese Art und Weise entstand der Bleichspargel, den wir als kräftige und gelblichweiße Stangen vom Gemüsestand auf dem Wochenmarkt oder aus dem Supermarkt kennen. Die ungebleichte Form, die im Frühling nicht mit Erde angehäufelt wird, ist der Grünspargel. Er ist um einiges dünner und hellgrün bis kräftig grün gefärbt. Auch ist sein Geschmack intensiver und würziger, was in der Küche durchaus auch geschätzt wird. Fazit: beim Spargel können wir sowohl ungeblichene, als auch etiolierte* Sprosse verwenden. Doch es gibt auch Gemüse, welche ohne Bleichvorgang so derb, dominant oder bitter schmecken würden, dass sie nur, wenn sie unter Lichtabschluss kultiviert wurden, essbar sind. Ein Beispiel hierfür ist der sogenannte Meerkohl, dessen Anbau (für Beschreibung dem Link folgen) ziemlich unbekannt ist. Da er aber ein leicht anzubauendes und dazu noch sehr ausdauerndes (mehrjährig) Gemüse ist, sollte er im Kleingarten durchaus seinen Platz finden.
Die klassischen Bleichgemüse sind:
- Spargel, Bleichspargel – wird tief gepflanzt und hoch angehäufelt
- Chicoree – treibt im warmen, dunklen Raum
- Bleichsellerie, Rippensellerie (das sind die Stangen vom Staudensellerie) – Pflanzung in Gräben; Erdanhäufelung; mittlerweile gibt es auch gelbe, milde Sorten, die nicht gebleicht werden
- Winterendivien – Abdeckhauben oder das Zusammenbinden der Außenblätter verhindern das Grünwerden der inneren Blätter
- Bindesalat (Römischer Salat) – Zusammenbinden der Blätter
- Löwenzahn – anhäufeln
- Meerkohl – austreibende Staude wird mit einem lichtundurchlässigen Gefäß (Eimer) bedeckt
- Cardy (Gemüseartischocke) – wenig bekannt; ausgewachsene Pflanze im September eng zusammenbinden, damit die inneren Blätter bleich und zart werden
- Porree – Pflanzung in flache Gräben, anhäufeln während der Kultur; nur der untere Teil der Blätter wird gebleicht
- Rhabarber – für zeitige und zarte Stängel stülpt man im Frühling einen Eimer über die Staude
- Blumenkohl – wird durch Bleichen zarter; die Blumenkohlblüten bilden sich unter den eingeknickten Blättern aus; im Spätherbst im Keller gelagerte Kohlköpfe treiben sogenannte Blütenkäse im Finstern
- Knollenfenchel – anhäufeln: es macht das Herbstgemüse zarter
Weniger bekannt ist, dass
die Kopfgemüse, wie Weiß-, Rot-, Butter- und Wirsingkohl in allen ihren Varietäten, der Rosenkohl und auch Kopfsalate und kopfbildende Zichorien und Endivien ihre Blätter bleichen. All diese genannten Blattgemüse bewirken durch eine angezüchtete Kopfbildung der Blattaustriebe einen natürlichen Bleichvorgang, den jeder dadurch feststellen kann, dass die Blätter beispielsweise des Kopfsalates nach innen zu immer heller und damit auch milder werden. Wie erwähnt, sind diese Kopfbildungen Auslesen und Züchtungen und nicht natürlicher Art. Bei einigen Gemüsen wie dem Bindesalat (Romanasalat) ist dieses wohl erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts gelungen. Moderne Romanasalate bilden längliche, geschlossene Köpfe aus, doch bei den älteren Sorten mussten die Blätter mit einem Bindfaden zusammengebunden werden. Daher kommt der alte Begriff Bindesalat.
*Etiolieren – Definition
Etiolieren leitet sich von Etiolemént ab (französisch étioler = verkümmern, dahinsiechen). Es bezeichnet das starke Streckungswachstum und das Ausbleiben der Chlorophyllbildung durch Lichtmangel und andere ungünstige Umweltbedingungen, geht aber über das Bleichen von Gemüse hinaus. Etiolemént bezieht sich zum Beispiel auch auf das Dunkelkeimen von Kartoffeln oder auf das Dünnbleiben von Rüben, wenn sie zu spät vereinzelt werden. Die deutsche Gärtnersprachte verwendet für das Wachstum unter Lichtmangel die Bezeichnung Vergeilen. [TJ.11.20] I
Literatur & Quellen
- Schubert/Wagner – Pflanzen und botanische Fachwörter; Radebeul 1984
- Kleine Enzyklopädie – Land-Forst-Garten; Leipzig 1959
- Rümpler Theodor – Illustrierte Gemüse- und Obstgärtnerei (Bearbeitete Auflage); Verlag von Wiegand, Hempel & Parey; Berlin 1879