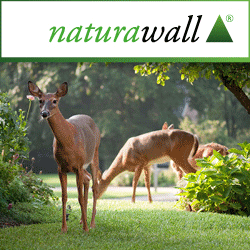Das Blattgemüse hat viele Namen wie beispielsweise Römer-Salat, Binde- oder Kochsalat, Lattich und auch Sommerendivie. Es findet vor allem in der mediterranen Küche Verwendung und ist aus der Mittelmeerküche nicht wegzudenken. Sowohl roh in Salaten, aber besonders auch zubereitet in Pfanne, Topf (dünsten) und Backofen wird es serviert. Es handelt sich also eher um ein Kochgemüse. Roh genossen ist es würziger, herzhafter und auch etwas derber, als die klassischen Kopfsalate. Wer sich für den Anbau entscheidet, sollte sich dessen bewußt sein. Nur wer gern kocht und in der Küche mit neuen Gemüsen experimentiert, für den wird sich der Aufwand lohnen. Für Kochmuffel wohl eher nicht.
Im Selbstversorgergarten, wo meist jeder Quadratzentimeter Gartenland ökonomisch genutzt wird, sollte der Romanasalat nur angebaut werden, wenn sicher ist, dass er auch in der Küche Verwendung findet und regelmäßig auf unserem Speiseplan steht, denn die Kultur benötigt viel Platz und entwickelt sich nur gut, wenn ihm der auch zugestanden wird. Für ein oder zwei Gerichte im Jahr kann man sich das Gemüse auch im Supermarkt kaufen. Eine unkompliziertere Alternative ist der Anbau von Zichoriengemüse (Endivien), das Anfang Juni ausgesät und vier bis sechs Wochen später auf frei gewordenen Flächen gepflanzt und im Herbst geerntet werden kann. Es gehört zwar zu einer ganz anderen Pflanzenart, doch ist es in der Küche ähnlich zu gebrauchen.
Nicht ohne Grund hat der Romanasalat auch den deutschen Namen Sommerendivie, was botanisch zwar nicht korrekt ist, doch leiten sich diese und einige ander Namensgebungen der Gemüseart vom Gebrauch in der Küche ab. Und so ist die Bezeichnung Sommerendivie durchaus berechtigt, weil die echten Endivien (auch Winterendivien genannt) zu den Herbst- und Wintergemüsen zählen und der Römische Salat im eigenen Anbau vor allem im Sommer verfügbar ist.
 2) Romanasalat anbauen: Ab März flach säen und auch beim Verpflanzen nicht zu tief setzen.
2) Romanasalat anbauen: Ab März flach säen und auch beim Verpflanzen nicht zu tief setzen.
Herkunft, Botanik, Beschreibung
Römersalat hat den botanischen Namen Lactuca sativa var. longifolia. Er stammt vermutlich aus dem Mittelmeerraum und dessen Umgebung und ist der Art nach ein Gartensalat (Lactuca sativa), der zur Gattung der Lattiche (Lactuca) zählt. Wenn du dem vorangestellten Link folgst, findest du alles weitere über Herkunft, Botanik und Geschichte dieser alten Kulturpflanze. Tatsächlich wurde das Blattgemüse und speziell die Varietät "longifolia" schon in der Antike in vielen verschiedenen Sorten kultiviert.
Die Bezeichnung longifolia, die so viel wie "langblättrig" heißt, weist auf die physiognomische Besonderheit der Romanasalate hin. Ihre Blätter haben nicht wie beim Kopfsalat eine rundliche Form, sondern sind länglich ausgeprägt. Außerdem sind sie stark gerippt und schließen sich meist nicht als Köpfe, sondern stehen aufrecht. Die alten Sorten wurden früher, wenn sich die Blätter voll ausgebildet hatten, mit einem Bindfaden zusammengebunden (daher der Begriff "Bindesalat"), damit die im Inneren befindlichen Salatherzen ausbleichen und dadurch milder schmecken. Spätestens seit dem 19. Jahrhundert werden aber auch Sorten angebaut, welche längliche Köpfe ausbilden und diesen Bleichvorgang (wie alle Kopfgemüse) quasi selber bewirken.
Vorteile
In der Einführung habe ich zunächst die Vorbehalte gegen den Anbau im Küchen- oder Kleingarten genannt. Doch nun will ich auch nicht vergessen, über die Vorzüge Aufschluss zu geben. Die Sorten der Romanasalate sind beim Anbau im Sommer, gegenüber den Kopfsalaten, schossfest. Das heißt, sie treiben bei Hitze nicht so schnell in den Samen, wie letztere. Aus diesem Grunde sind sie prädestinierte Sommersalate. Ein weiteres Argument für die Entscheidung, den Lattich im Hausgarten anzubauen ist, dass diese Gemüse auch eine zierende Wirkung haben. Es sind gesunde, frischgrüne Pflanzen, welche sofort ins Auge fallen. Sorten, wie 'Forellenschluss' haben sogar noch eine gesteigerte Zierwirkung durch das den Forellen gleiche Farbspiel der Blätter, wie im Bild 2) zu sehen. Wer es arbeitsmäßig schafft, der sollte seinen Obst- und Gemüsegarten mit vielen Ideen, Ziergemüsen und blühenden Kräutern in einen "Ziergemüsegarten" verwandeln. Das ist die wirkliche Gartenkunst, welche in Akademien nicht gelehrt wird.
Anbauanleitung – Pflegetipps
Die Kultur unterscheidet sich nicht wesentlich von derjenigen der Kopfsalate (bitte dort genauer informieren), der Boden sollte aber möglichst in noch besserer Dungkraft stehen, als bei letzteren. Man sät ab März ins Frühbeet und von April bis zum 20. Juni ins freie Land. Wer das Gemüse beständig ernten möchte, wiederholt die Saaten ab April alle 14 Tage. Die Saattiefe beträgt 0,5 bis 1 Zentimeter, da die Pflanze ein Lichtkeimer ist. Im Sommer sollten wir kühlere Tage für die Saat nutzen, da bei Temperaturen über 16°C die Saat schlecht aufgeht. Der Samen ist vier bis fünf Jahre keimfähig, und die Keimdauer liegt bei sieben bis zehn Tagen. Sowohl der Reihen- als auch der Pflanzabstand der Setzlinge beträgt jeweils 30 Zentimeter, weswegen die Jungpflanzen im Dreiecksverband gesetzt werden.
Bei der Pflanzung ist darauf zu achten, dass die Sämlinge (die reichlich Wurzeln haben sollten) nicht zu tief eingesetzt werden, da sie sonst leicht faulen. Man drückt sie in der Erde gut fest. Danach wird vorsichtig angegossen. Wenn die Pflanzen angewachsen sind, muss zwar sehr regelmäßig gegossen werden (regelmäßiger, als beim Kopfsalat), doch auch nicht im Übermaß. Gelegentliche Bodenlockerung, besonders nach starken Gewittergüssen, und die Entfernung von Unkräutern sind die wichtigsten Pflegearbeiten. Gedüngt wird moderat (einmaliger Jaucheguss bei Regenwetter). Die Gewächse sind keine Starkzehrer. Wie bereits bei der Wasserversorgung ist auf die Ausgewogenheit der Düngung zu achten. Wenn im Garten Wasserknappheit herrscht, dann ist es vorteilhaft, die Pflänzlinge direkt an Ort und Stelle zu säen und nicht zu verpflanzen. Dann bilden die Stauden tiefer gehende Wurzeln und holen sich die Feuchtigkeit aus den tieferen Bodenschichten und ebenso die Nährstoffe.
Alte Sorten als Bindesalat behandeln
Mit Ausnahme der sich selber schließenden Sorten müssen nun bei den alten urtümlichen Sorten die Blätter gebunden werden, damit sie bleichen. Der Fachbegriff dafür ist das Etiolieren. Das geschieht, wenn sich die Stauden voll entwickelt haben. Es werden dann bei freundlicher, trockener Witterung die Blätter mit der Hand zusammengenommen und an zwei bis drei Stellen mit Bindfaden fest zusammen gebunden. Nach diesem Verschnüren dürfen die Stauden nur noch am Fuße gegossen werden. Bereits nach 14 Tagen hat das Binden seinen Zweck erfüllt und die Herzen und inneren Blätter sind dann durch den Lichtmangel gelb, knackig und mild im Geschmack geworden.
Lagerung
Römischer Salat ist nicht besonders frostfest. Wenn er spät angebaut wurde (Aussaat-Zeitpunkt im Juni, Ernte im Herbst), dann können die entwickelten Stauden aber im Keller oder in einem entsprechend frostfreien Raum (Gartenhaus) eingeschlagen werden. Dafür nimmt man sie mit Wurzeln aus der Erde heraus und setzt ("pflanzt") sie in eine Kiste mit Sand (oder gesiebter Erde), aber so, dass sie sich nicht gegenseitig berühren. So lassen sie sich für länger Zeit aufbewahren. Wie lange hält sich Romanasalat im Kühlschrank? Hier ist das Blattgemüse im Gemüsefach gut 14 Tage haltbar. Um das Welken der Blätter zu verhindern umwickle man den Lattich mit befeuchtetem Papier.
Verwendung – Römersalat
Die Verwendung der Romanasalate in der Küche wurde bereits eingangs erwähnt, nun soll hier noch der Hinweis auf den USA-Salat-Klassiker "Caesar's Salad" erfolgen. Die Grundzutaten sind neben den Blättern Parmesankäse, Tostwürfel, Knoblauch, reichlich Olivenöl, Dressing und Butter. Eine kulinarische Besonderheit aus Nordhessen sind die Kasseler Strünkchen, auf welche unten ausführlicher eingegangen wird.
Interessant finde ich einen Hinweis bei Johannes Böttner [1], der sinngemäß schreibt: In Süddeutschland und Elsaß ist der Lattich sehr beliebt, weil man dort die Blätter mit dickfleischigen Rippen liebt, während man in Norddeutschland die Rippen wegwirft und weiche, zarte Blätter verlangt.
Sorten
Wie schon im alten Rom, können auch heute sehr viele und verschiedene Sorten gekauft werden, von denen ich unten nur einige wenige als Beispiel nenne. Die schönste Variante ist aber sicher immer noch die über hundert Jahre alte Sorte Forellenschluss:
- 'Forellenschluss' – 40 cm hoch; grün mit braunroten Flecken; samaenfest; die Vorläufersorte 'Forellen-Römersalat' bildete noch keine Köpfchen; etwa ab 1870 entstand die Auslese, bei welcher sich die Blätter schlossen, daher der Name; eine Parallelsorte ist 'Goldforellensalat' mit reingelben, braungesprenkelten Blättern und ausgiebigen Ernten
- 'Little Gem' – 18 cm hoch werdend; bildet kleine, zarte Salatherzen aus; samenfest; Pflanzabstand 20 x 20 cm ausreichend
- 'Little Leprechaun' – Wuchshöhe 18 cm; längliche, schlanke Köpfe mit schwarzrot überhauchten Blättern; kann auch als Schnittsalat verwendet werden
- 'Roter Feldsalat Ovired' – 8 bis 10 cm hoch; eine moderne Sorte zum Garnieren von Speisen; botanisch kein Feldsalat, sehen die Pflänzchen ähnlich aus, weil sie quasi als Jungpflanzen geerntet und verwendet werden; Aussaat (breitwürfig) von März bis August möglich; verträgt keinen Frost
Besonderheit – Sorte: 'Kasseler Strünkchen' (Strunksalat)
Unter dem Namen 'Kasseler Strünchen' (Strunksalat, Schlupperkohl) wird in der Region um Kassel seit dem 19. Jahrhundert ein sogenannter Spargelsalat kultiviert, welcher dem Lactuca sativa var. longifolia zuzuordnen ist. Dieser Salat wächst mit einem zentralen fleischigen Stängel, der in seiner ganzen Länge mit breit-lanzettlichen, zugespitzten Blättern besetzt ist, etwa 75 Zentimeter hoch.
Anbau der 'Kasseler Strünkchen'
Die Samen werden Mitte April ins freie Land gesät. Sind die aufgegangenen Pflanzen stark genug geworden, kommen sie auf ein gut vorbereitetes, nahrhaftes Beet. Der Pflanzabstand beträgt 45 Zentimeter. Die Pflanzen bleiben dann so lange bei guter Pflege, bis die geschlossene Blätterkrone auseinander geht, ins Kraut schießt und den Strunk ausbildet. Das geschieht in der Regel im Juli und dann ist das Stielgemüse erntereif.
Traditionelle Zubereitung (Rezept für Fermentierung)
Die fleischigen Sprosse wurden traditionell für ein sehr geschätztes Einmachgemüse benutzt. Sie werden über dem Boden abgeschnitten, die Blätter entfernt, geschält und in zentimeterdicke Scheiben geschnitten. Ganz harte und zu weiche Stängelabschnitte werden dabei nicht verwendet.
Hier folgt nun ein altes Originalrezept für die Fermentierung: Die Strünkchen, wie man sie nennt, werden gehörig gesalzen und bleiben mindestens 12 Stunden stehen, worauf die Lake abgegossen wird. Nun werden die Strünkchen mit Salz abermals recht gleichmäßig gemengt und wie Sauerkraut in einem Gärtopf eingemacht. Man kann auch eine Lake aus 1/4 Liter (250 g) Wasser mit 12 Gramm Salz gemischt herstellen und das Gemüse im Gärtopf damit übergießen. Ein weiteres Rezept zur Fermentierung von Spargelsalat ist hier zu finden und abzugleichen.
In einem Keller oder an einem sonstigen kühlen Ort aufgestellt hält sich diese milchsauer eingelegte Konserve vortrefflich und bis in den Winter hinein. Für die Zubereitung der Strünkchen wird die erforderliche Portion aus dem Gefäß genommen, abgespült, gekocht und mit einem Durchschlag das Wasser abgegossen. Die heißen Strünkchen werden dann noch mit Butter und Schmand (saure Sahne, Creme fraiche) verfeinert und als Gemüsebeilage serviert. "So hat man ein Gericht, welches dem schönsten Blumenkohl nicht nachsteht." [2]
[TJ.8.9] Thomas Jacob, November 2017
Literatur & Quellen:
- [1] Böttner, Johannes; Gartenbuch für Anfänger; Frankfurt a.d. Oder, 1902; Seite 175
- Lange, Theodor; Allgemeines Gartenbuch. Band 2: Gemüse und Obstbau; Leipzig, Spamer, 1908
- [2] Th. Rümpler; Illustrierte Gemüse- und Obstgärtnerei (Bearbeitete Auflage); Verlag von Wiegand, Hempel & Parey; Berlin 1879; Anbau und Rezept Kasseler Strünkchen auf Seite 195
- Sobischek, Josef; Der kleine Garten; Wien und Leipzig, um 1940