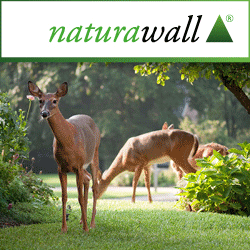Die Haferwurzel (Tragopogon porrifolius), auch Purpur-Bocksbart genannt, ist ein uraltes Wurzelgemüse und wurde bereits in der Antike im römischen Weltreich angebaut. Noch im 19. Jahrhundert war es in den Gärten bei uns beliebt, wurde jedoch dann im 20. Jahrhundert nach und nach von der Schwarzwurzel fast völlig verdrängt. Diese bringt eindeutig höhere Erträge als Haferwurzel, konnte allerdings anfangs nur im zweijährigen Anbau kultiviert werden, da es keine Sorten für den einjährigen Anbau gab. Züchtungen, die Schwarzwurzelsorten für die einjährige Kultur zum Ergebnis hatten, machten der Haferwurzel dann fast den Garaus, denn diese war bis dahin mit ihrer einjährigen Kultur konkurrenzlos gewesen. Heute wird das Wurzelgemüse immer beliebter und wird von Kleingärtnern, die Gemüsevielfalt proklamieren, immer häufiger angebaut.
Nicht zuletzt ist es aber auch der Umstand, dass die Haferwurzel in Gärten, in denen die Schwarzwurzel auf Grund ungünstiger Bodenverhältnissen schlecht aufgeht und nicht so recht gedeihen will, eine gute Alternative für das Delikatessgemüse darstellt. Besonders schwerer, klebriger Boden, der nach Regengüssen rasch verkrustet, macht der Haferwurzel weniger aus.
Botanik und verwandte Gemüsearten
Neben Purpur-Bocksbart sind Namen wie Weißwurzel, Porreeblättriger Bocksbart, Habermark und Austernpflanze weitere deutsche Synonyme für die Haferwurzel (französisch Salsifis blanc, englisch Salsify).
Der schöne Name "Purpur-Bocksbart" bezieht sich auf die eigentümlichen lilaroten Blüten, welche im Mai in den Morgenstunden an den kniehohen Pflanzen erscheinen. Dabei liegen die Hüllblätter zum Teil genau hinter den Blütenblättern und mögen auf diese Art wohl wie Bärte von Ziegenböcken aussehen. Auf jeden Fall sind die blühenden Pflanzen schön anzusehen, und wir sollten einige Exemplare dieser ausdauernden Pflanze zur Gewinnung von Samen im Garten stehen lassen. Zierend sind auch die Blätter, die wie Grasbüschel aussehen. Das Laub hat ein gesundes, helles Grün, und ihm ist dieselbe merkwürdig gedämpfte Farbausstrahlung wie den Blüten zu eigen.
 2) Die Blüte der Haferwurzel mit ihrem charakteristischen Altrosa.
2) Die Blüte der Haferwurzel mit ihrem charakteristischen Altrosa.
Die Haferwurzel (Tragopogon porrifolius) ist eine Art der Pflanzengattung der Bocksbärte (Tragopogon). Die Gattung wird der Unterfamilie (Tribus) Cichorioideae zugeordnet. Die Pflanzenfamilie ist die der Korbblütler (Asteraceae) und diese gehört zur Ordnung der Asternartigen (Asterales). Die Verwandtschaft mit der Garten-Schwarzwurzel (Scorzonera hispanica) ist relativ nahe. Die Gattung der Schwarzwurzel (Scorzonera) gehört ebenfalls zur Unterfamilie der Cichorioideae. Zu dieser Unterart zählen auch weitere Gartenpflanzen wie Löwenzahn (Taraxacum), die Gartensalate (Lactuca) und die Zichorien-Salate (Cichorium). Mitunter findet sich die Haferwurzel auch als "Bocksbart" verwildert in der Kulturlandschaft. So viel zur botanischen Einordnung dieses Gemüses.
Anbauanleitung nach Rümpler
In vielen Anbauanleitungen und Gartenbüchern wird der Anbau häufig dem der Schwarzwurzel gleichgesetzt. Ausgehend von diesen Informationen könnten wir die Anleitung zum Anbau der Haferwurzel kurz fassen. Aber es gibt auch eine kaum bekannte, alte, recht spezielle Art der Kultur der Haferwurzel, die darauf abzielt, recht lange Wurzeln zu erzeugen und möglichst keine Seitenwurzeln auszubilden. Ohne diese individuelle Anbaumethode verzweigt sich dieses Wurzelgemüse häufig sehr stark. Theodor Rümpler beschrieb diese von ihm selber entwickelte Anbaumethode in seinem Buch Illustrierte Gemüse- und Obstgärtnerei [1].
Bodenverhältnisse und -vorbereitung
Theoretisch verlangt die Haferwurzel einen "mürben, frischen, tiefen und im vorigen Jahr gut gedüngten (mit Mist) Boden." Darauf wird dann in Reihen oder breiwürfig im März oder April gesät. Die breitwürfige Saat deshalb, weil die Gewächse besser alle mit reichlich Platz zueinander stehen. Doch wie bereits erwähnt, bilden sich bei dieser Form der Kultur oft auch verästelte Wurzeln aus, die dann in der Küche nur aufwändig zu putzen sind. Die Besonderheit beim Rümler-Anbau ist aber diese, dass man ein Beet wählt, welches mindestens zwei Jahre lang nicht gedüngt wurde – also den nährstoffärmsten Gartenboden. Dort wird ein 20 Zentimeter tiefer Garben spatenbreit ausgehoben. dann kommt auf die Sole des Grabens gut fünf Zentimeter bestens verrotteter Dung oder durch Jauche aufgebessert gut verrotteter Kompost [2] und dann wird dieser Dünger mit dem Untergrund vermischt.
Zusätzlich kann auch noch eine Gartenjauche auf den Grund des aufgeworfenen Grabens eingebracht werden. Dann wird der Graben mit dem nährstoffarmen Boden wieder verfüllt und leicht angetreten (verfestigt) und oberflächlich etwas gehackt und geharkt um ihn für die Aussaat vorzubereiten.
Aussaat
Dann werden mit der Schnur Saatrillen gezogen mit Reihenabstand 15 Zentimeter. Es wird nicht zu dicht gesät: zwei Zentimeter tief. Der optimale Aussaatzeitpunkt liegt im Monat März und April. Das ist etwas später, als der Aussaattermin der Schwarzwurzeln. Nach dem Aufgehen der Samen und dem ersten Erstarken der Pflänzchen werden die Pflanzen im Ende Mai auf 10 Zentimeter Abstand vereinzelt. Man schneidet die überzähligen Pflänzchen heraus (Messer/Schere), aber man reißt sie nicht heraus, was die Wurzeln der Nachbarpflänzchen schädigen würde. Nun werden die Pflanzen ihre Wurzeln schnell in die Tiefe strecken, um von dort das reiche Nahrungsangebot schöpfen zu können. Nebenwurzeln bilden sich auch Mangel an Nahrung kaum und somit bleibt die Hauptwurzel gerade und unverästelt, sowie wir sie uns optimalerweise wünschen.
Pflege
Nachdem die Haferwurzelpflänzchen aufgelaufen sind, muss mitunter schon einmal zwischen den Reihen vorsichtig das Unkraut gehackt werden. Bei Trockenheit wird gegossen.
Das sind die Arbeiten, bis zum Herbst, welche von Monat zu Monat jedoch weniger werden, da sich die Tiefwurzler auch bald das benötigte Wasser aus der Tiefe holen.
 Die Haferwurzel mit schmalen grasartigen Blätter im Anbau in Mischkultur.
Die Haferwurzel mit schmalen grasartigen Blätter im Anbau in Mischkultur.
Ernte
Ab Herbst können die Wurzeln geerntet werden. Man sticht sie vorsichtig mit dem Spaten tief heraus. Ist der Boden sehr fest, dann macht man neben den Pflanzen einen schmalen Graben und sticht dann die Haferwurzeln so heraus, dass sie in Richtung dieses Grabens gedrückt, und leicht herausgezogen werden können. Der kleine Mehraufwand bei der Ernte kommt aber auch gleichzeitig wieder der Bodengüte zugute, denn beim Anbau der Weißwurzeln überhaupt wird der Boden mal wieder ordentlich gelockert. Das ist übrigens bei etlichen Wurzelgemüsen der Fall und der Autor hat diese immer nebeneinander im Anbau konzentriert und rückt dann mit diesem Schlag bestellter Wurzelgemüsefläche im Garten systematisch weiter. Auf diese Weise wird nach etwa fünf Jahren die gesamte Beetfläche des Gemüsegartens einmal tiefgründig gelockert und so dann auch turnusmäßig weiter.
 Bei der März-Ernte können Wurzeln und junge Blätter (für Salate) in der Küche Verwendung finden.
Bei der März-Ernte können Wurzeln und junge Blätter (für Salate) in der Küche Verwendung finden.
Da die Haferwurzel ist winterhart und sie kann zur Ernte, was sehr praktisch ist, über den Winter auf dem Beet bleiben. Damit wir auch bei Frost ernten können, ist es ratsam einen Teil dieser Fläche mit Laub oder ähnlichen Materialien abzudecken, damit dort der Frost nicht in den Boden eindringt. Sind die Wurzeln einmal ausgegraben, sollten sie sofort verarbeitet werden. Liegen über einen Tag, dann werden sie bereits schlapp. Wir können die Wurzeln aber auch im Herbst herausgraben und dann im Keller in Sand einschlagen.
Eigene Samenzucht
Die eigene Gewinnung von Saatgut ist unbedingt angeraten, weil eigentlich nur frischer Samen einwandfrei aufgeht. Für diese Zwecke nehmen wir von der Ernte die fünf schönsten Wurzeln und graben sie an einem ungestörten Platz, der auch teilweise leicht überschattet sein kann, wieder ein. Dort werden sie gehegt und gepflegt, bis sie im Mai blühen und dann Samen entwickeln. Die Ernte der Samen, welche am Grunde kleiner "Pusteblumen" reifen, geschieht nach und nach. Sind die Samen abgeerntet, so können wir die alten Pflanzen herausnehmen. Sie bleiben nicht stehen.
Erfahrungen und Bewertung
Für den Anfänger in der Kleingärtnerei ist die Zucht der Haferwurzeln sicher nicht geraten. Das A und das O der Kultur ist letztlich die eigene Samengewinnung, was mindestens zwei Jahre Kulturzeit dauert. Mittelfristig sollten wir das Wurzelgemüse jedoch in unseren Anbauplan vorsehen, denn in schlechten Schwarzwurzel-Jahren ist sie eine gute Ersatzkultur. Das ist vor allem der Fall, weil bei Ausfällen der Schwarzwurzel diese im April nicht mehr nachgesät werden kann. Bei dieser späten Aussaat bekommt man bei dieser Kultur keine lohnenden Erträge mehr. Allerdings können wir im April die Haferwurzel nachsäen und auch in die Lücken einer Schwarzwurzelreihe.
Ein weiterer Grund zur Entscheidung für das alte Wurzelgemüse wurde oben bereits genannt. Es ist die unbedingt nötige Bereicherung, also die Vielfalt an heimischen Gemüsearten, denn hier haben wir in den letzten 120 Jahren eine unwürdige Verarmung hinnehmen müssen. Allein, was die ähnlichen Wurzelgemüse betrifft, so baute man noch um 1900 neben der besagten Schwarz- und Weißwurzel folgende Kulturen an: Goldwurzel (Scolymus hispanicus), Klettenwurzel (Bardanae radix), Raponica (Gemeine Nachtkerze, Oenothera biennis), Zuckerwurzel (Sium sisarum), Knollenziest (Stachys affinis), Yams (Lichtwurzel, Dioscorea polystachya), Süßkartoffel (Ipomoea batatas), Erdmandel (Cyperus esculentus) und Rapunzelrüben (Ährige Teufelskralle, Phyteuma spicatum [3].
Quellen und Erläuterungen
—
[1] Rümpler, Theodor; Illustrierte Gemüse- und Obstgärtnerei (Bearbeitete Auflage); Verlag von Wiegand, Hempel & Parey; Berlin 1879
—
[2] Es kann auch mit Stickstoffdünger aufgebesserter Kompost sein. Auf jeden Fall muss Mistdünger und Kompost gut verrottet sein, damit das organische Material im Boden nicht fault.
—
[3] Lange, Theodor; Allgemeines Gartenbuch. Band 2: Gemüse und Obstbau; Leipzig, Spamer, 1908
—
[TJ.18.4] I ©Bildrechte und Text: Thomas Jacob