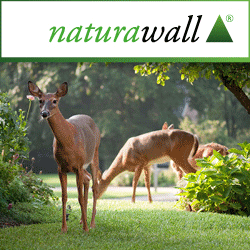Die Küttiger Rüebli sind urtümlich Mohrrüben (Daucus carota subsp. sativus) im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie ähneln im Äußeren mehr einer Rübe, wie das Bild 2) gut dokumentiert, als einer Möhre. Sie ist ihrer Herkunft nach eine echte Regionalsorte und stammt aus dem Aargauer Dorf Küttigen in der Schweiz. Ich habe sie in ihrer Eigenschaft als Selbstversorger-Gemüse getestet und habe mit dieser alten, samenfesten Gemüsesorte beste Erfahrungen gemacht.
Besondere Eigenschaften und Geschmack
Allgemein ist in den Beschreibungen zu lesen, dass die Küttiger Rüebli zu den robusten Möhrensorten zählen. Das kann ich sofort bestätigen. Werden in meinem Garten die gewöhnlichen Karotten nicht selten von der Möhrenfliege heimgesucht, so blieben die Rübchen bisher davon verschont. Ist ihr Samen erst einmal aufgegangen, dann bilden sich kräftige, gesunde Pflanzen aus, und die Belaubung wirkt (im Herbst) nicht nur gefühlt grüner und gesünder, gegenüber den gängigen Hochzucht-Mohrrüben, sondern ist es auch. Dabei müssen sie im Vergleich zu den Letztgenannten nicht auf ganz so tief bearbeitetem Boden stehen.
Was den Geschmack angeht, so ist er bei den rohen Rüebli nicht so kräftig, wie bei einer Karotte und auch nicht ganz so süß, insgesamt aber um einiges milder. Auf keinen Fall haben sie diesen grantigen Möhrengeschmack, der so manch anderen Sorten anhaftet. Man schmeckt beim Rohgenuss aber durchaus, dass man es mit einer Möhre zu tun hat. Anders ist es beim Verarbeiten in der Küche. Im gedünsteten Zustand ist das Mohrrübenaroma fast gänzlich verflogen, und das Gemüse hat einen sehr milden Grundgeschmack. Hier kommt es nun auf das Geschick der Köchin an, die Rüebli klassisch oder experimentell zu verfeinern. Auch im Wok sollte man sie probieren. Die Wurzeln haben ein, dem Auge angenehmes, weißes Fleisch, welches auch beim Dünsten dieses Schneeweiß nicht verliert und damit auch dekorative Zwecke erfüllt.
 2) Die weißen, gleichmäßig geformten, rübenartigen Möhren ähneln ein wenig den Pastinaken, schmecken aber besser.
2) Die weißen, gleichmäßig geformten, rübenartigen Möhren ähneln ein wenig den Pastinaken, schmecken aber besser.
In der Herkunftsregion wurden die Küttiger Rüebli traditionell auch fermentiert (in Salzlake eingelegt) oder auf eine merkwürdige Art und Weise gedörrt, indem sie zuerst gekocht, dann gestiftet und zuletzt auf dem Ofen getrocknet wurden. Anfangs baute man sie überwiegend als Futterpflanze an, und sie galt lange Zeit als Armeleute-Essen. Erst seit die Aufmerksamkeit der Gesellschaft wieder mehr auf rustikale und vor allem auch regionale Gemüse gelenkt wird, kommen die Rübchen durchaus auch auf die Teller vornehmer Restaurants.
Im Selbstversorgergarten gehören Küttiger Rüebli zu den Wintergemüsen, das heißt, sie sind gut lagerbar und halten sich unter entsprechenden Bedingungen bis ins zeitige Frühjahr hinein. Praktisch finde ich weiterhin, dass sie sehr ergiebig sind und man für eine Mahlzeit nur wenige Exemplare benötigt.
Anbauanleitung
Was die Standortverhältnisse betrifft, so unterscheidet sich der Anbau nicht von dem der klassischen Möhrensorten. Allerdings liegt der Aussaatzeitpunkt der Küttiger Rüebli relativ spät, um den 15. Mai, nach den Eisheiligen. Da gewöhnliche Möhren früher ausgesät werden, probierte ich es auch einmal bei den Rüebli mit einer frühen Saat im März. Das bescherte mir 100 Prozent Ausfall, wohingegen die Mai-Saat 100 Prozent Erfolg brachte.
 3) In der Literatur häufig empfohlener Abstand für den Anbau.
3) In der Literatur häufig empfohlener Abstand für den Anbau.
Gesät wird relativ flach, maximal einen Zentimeter tief. Ich baue intensiv auf langen, schmalen Beeten an und habe auf einem Beet drei Reihen mit Abstand von jeweils 15 Zentimetern. Vereinzelt hatte ich dann auf 12 Zentimeter, wie im Bild 3) zu sehen ist, was aber nicht unbedingt nötig ist. Neun Zentimeter Pflanzabstand halte ich für ideal. Wie alle Möhrensamen brauchen auch die der Rüebli lange zum Keimen. Nach drei Wochen sollten dann aber die ersten grünen Spitzen zu sehen sein. Die weitere Pflege gleicht denen der Möhre. Gegossen wird nur bei großer Trockenheit. Im Ursprung ist das Gewächs ohnehin eine Feldfrucht, und wer einen Garten ohne Wasseranschluss hat, der braucht auch gar nicht zu gießen. Wenn die Rübchen sichtbar werden, kann man sie etwas Anhäufeln, was die Möhrenfliegen abhalten soll.
Eine klassische Mischkultur mit anderen Gemüsen halte ich nicht für sinnvoll. Dagegen ziehe ich diesen Mischkulturanbau, der früher in den Bauerngärten üblich war, prinzipiell vor. Dabei werden statt Normalbeete (1,2 m x 2 m) lange schmale Beetstreifen angelegt und mit wechselnden Kulturen, die auf diese Weise nebeneinander wachsen, kultiviert.
Ernte
Haben wir zu dicht gesät, so wird im Juni zum ersten Mal verzogen, wobei nicht alle Exemplare schon im idealen Abstand stehen müssen. Durchaus kräftige, aber zu dicht stehende Rübchen können noch bis August weiterwachsen und werden bei einem zweiten Durchsehen geerntet, was der Küche junges Gemüse liefert. Etwa ab September kann komplett geerntet werden, und spätestens Anfang November, an einem trockenen Tag, gräbt man dann alle Wurzeln aus, schneidet das Kraut ab und lagert sie wie Mohrrüben in Sand ein. Dort halten sie sich über den ganzen Winter lang frisch halten.
Bei der Lagerung schrumpeln die Wurzeln nicht so schnell, wie das bei den Möhren häufig der Fall ist, sodass man sie zum Beispiel in einer Erdmiete nicht mit Sand bedecken muss. Das ist ein wirklicher Vorteil gegenüber den gewöhnlichen Möhren. Die Rüebli sind also ein sehr gutes Lagergemüse und sollten im Selbstversorgerhaushalt auch so gebraucht werden. Das Möhrenkraut kann als Kleintierfutter (Kaninchen) verwertet werden, und entsprechend kleingeschnitten fressen es sogar die Hühner.
Selber vermehren
Das nötige Saatgut kann, traditionell wie bei Möhren, selber gewonnen werden. Ich mache das, indem ich von den überwinterten Rüben (aus dem Einschlag oder eingesandet im Keller) drei schön geformte, mittelgroße Exemplare auswähle und sie im März an einer Stelle im Garten einpflanze, wo sie nicht stören. Bis zum Sommer bilden sie etwa einen Meter hohe Stängel mit weißen Blütendolden aus, wie im Bild 4) zu sehen. Damit diese nicht umfallen, werden die Stängel locker an einem Stab angebunden. Die doldenartigen Blütenstände sind zudem sehr dekorativ, sodass man sie im Hausgarten durchaus auch in eine Blumenrabatte einfügen kann. Dort können sie in Ruhe wachsen und ausreifen zudem, wenn auf den Gemüsebeeten nicht ausreichend Platz dafür ist.
 4) Blütendolden der Küettiger Rüebli
4) Blütendolden der Küettiger Rüebli
Da die Dolden unterschiedlich ausreifen, schneide ich jeweils die trockenen Samenstände ab und lagere sie zum Nachreifen im Gartenhaus in einer Schüssel. Irgendwann im Winter, wenn Zeit genügend vorhanden ist, werden die Samen ausgerieben und in einem Glas mit Schraubdeckel trocken aufbewahrt. Dort bleiben sie drei Jahre keimfähig. Es ist bei der Samengewinnung darauf zu achten, dass zur selben Zeit keine anderen Möhren blühen, auch keine wilden, da es sonst zum Sortenmix kommen kann. Die Gewächse gehören zu den Pflanzen, bei denen die Einkreuzungsgefahr** mit anderen Formen sehr hoch ist, doch viel passieren kann dabei nicht, da wir daheim keine Hochzuchtsorten herstellen. Über die Jahre wird man auch keine sortenechten Küttiger Rüebli haben, sondern eine neue eigene, echte, regionale Landsorte. [TJ.7.13]
Quellen und Ergänzungen, Fermentation:
* Bei den Rezepturen für das Fermentieren wird in der Regel auf 1 kg kleingeschnittenes Gemüse 1 Esslöffel Salz genommen. Braucht man noch zusätzliche Lake, wird 1/4 Liter (250 g) Wasser mit 12 g Salz gemischt. Ein Teelöffel voll Salz entspricht etwa 5 g.
** Theoretisch muss in der Blütezeit 1 km Abstand zu anderen Sorten eingehalten werden, doch in der Praxis fallen Sortenentartungen minimal aus.
Weiterhin:
– eigene Anbauerfahrung
– https:// de.wikipedia.org/wiki/Küttiger_Rüebli